Der Schwur – Dritter Teil – Kapitel 11
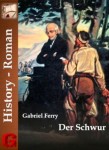 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Dritter Teil
Der See Ostuta
Kapitel 11
Phantasie und Wirklichkeit
Es schien, als ob die noch vor Kurzem so öden Ufer des Sees Ostuta plötzlich der Ort eines allgemeinen Wiedersehens geworden wären, denn auch in der Ferne erglänzten Lichter. Es wurde in entgegengesetzter Richtung von der, welche die Sänfte Gertrudis’ einschlug, eine andere Sänfte sichtbar, welche von Männern getragen wurde.
Ein halbes Dutzend Indianer gingen ihr voraus und erhellten den Weg mit brennenden Kiefernzweigen.
Bei dem Klang der Stimme Don Rafaels hatte die Eskorte Gertrudis’ haltgemacht. Fast in demselben Augenblick wurde auch die am entgegengesetzten Ufer des Sees angelangte Tragbahre niedergesetzt. Die Indianer, die sie geleiteten, schickten sich darauf an, mit ihren Fackeln das Schilf zu durchsuchen.
Eine Entfernung von zwei- bis dreihundert Schritten trennte die Gruppen voneinander, welche die beiden Sänften umgaben.
Costal war aufgebracht, die Ufer des Sees von Neuem besetzt zu sehen, schnell nach jener Seite geeilt und trieb, indem er einem Indianer seine Fackel entriss, sein Pferd schleunigst zu der Sänfte heran.
Die Träger derselben, erschreckt vom Anblick eines Reiters, der mit zornentflammtem Gesicht, die Zügel zwischen den Zähnen, in der einen Hand eine Fackel, in der anderen einen noch bluttriefenden Degen hielt, ließen ihre Bürde mit Heftigkeit auf den Boden fallen und flohen, so schnell ihre Füße sie zu tragen vermochten.
Ein unterdrückter Schrei ließ sich aus der Sänfte hören, deren Vorhänge der Hauptmann, der Costal gefolgt war, sogleich öffnete. Beim Schein der Fackel des Kazikennachkömmlings wurde ein blasses, mit Blut bespritztes Gesicht sichtbar, in dem Don Cornelio sogleich den jungen Spanier wiedererkannte, der das Opfer der Grausamkeit Arroyos und der Habsucht seines feigen Gefährten geworden war. Der Sterbende schreckte beim Anblick des Indianers zusammen und sagte mit fast erloschener Stimme: »O, tut mir kein Leid, ich habe nur noch sehr kurze Zeit zu leben!«
Lantejas machte Costal ein Zeichen, sich zu entfernen, und beseitigte die Furcht des unglücklichen jungen Mannes durch liebreiche Worte.
»Dank! Dank!«, flüsterte dieser, und indem er einen flehenden Blick auf den Hauptmann richtete, fügte er hinzu: »Habt Ihr sie nicht gesehen?«
Diese Worte waren ein Lichtstrahl für Don Cornelio. Das aus der Hazienda San Carlos fliehende Gespenst und die weiße Erscheinung im Schilf des Sees waren in seinen Augen jetzt nichts mehr als ein und dasselbe unglückliche Geschöpf. Zweimal hatte er die noch lebend gesehen, die der Spanier ohne Zweifel nur tot wieder erblicken sollte. Noch ganz von den letzten Vorgängen der Nacht verwirrt und überhaupt befürchtend, die letzten Augenblicke eines Sterbenden zu verbittern, wusste Don Cornelio weiter nichts zu antworten.
»Ich weiß nicht«, sagte er stockend, »ich habe niemanden weiter gesehen als Räuber, von denen zwei getötet worden sind.«
»Sucht sie, um Gottes willen!«, entgegnete der Spanier, »sie kann nicht weit von hier sein. Ich spreche von meiner Frau. Wir haben hier in der Nähe dieses seidene Tuch gefunden – noch mehr, diesen Schuh. Ach, wenn ich nur meine Marianita noch einmal umarmen könnte, ehe ich sterbe!«
Mit diesen Worten zeigte der junge Mann voll Angst und mit flehender Gebärde diese beiden Gegenstände, welche der gehört hatten, die er in dem Schilf des Sees wahrscheinlich leblos wiederfinden sollte.
Der Hauptmann ließ die Vorhänge der Sänfte wieder zurückfallen und eilte zu Costal, der bei dem Gedanken, den ihm die grausame Enttäuschung seiner Hoffnungen verursacht hatte, vor Wut schäumte.
Don Cornelio wollte ihm seine Befürchtungen in Betreff der jungen Frau mitteilen.
»Ihr seid ein Narr!«, unterbrach ihn der Indianer in übelster Laune. »Die Frau, welche Ihr im Schilf gesehen habt, ist Matlacuezc, und ich stand im Begriff, sie mit meinen Armen zu umschlingen, als dieser nichtsnutzige Bandit kam. Deshalb verschwand sie«, fügte er in voller Wut hinzu.
»Ihr seid der Narr, unseliger Heide! Das unglückliche Geschöpf, das wahrscheinlich die für Euch bestimmte Kugel durchbohrt hat, ist niemand anders als die Frau jenes bedauernswerten jungen Mannes.«
Während der Hauptmann mit auf die Sänfte gerichteten Augen die Illusionen zu zerstören suchte, in denen Costal befangen war, hatten die von ihrem Schrecken zurückgekommenen Fackelträger Don Fernandos ihre Nachforschungen am Ufer des Sees wieder aufgenommen.
Plötzlich stieß einer von ihnen einen schrecklichen Schrei aus.
»Hier ist sie!«, rief er.
Dann folgte diesem Schrei ein dumpfes Geheul nach indianischer Weise. Dieses Geheul belehrte den Spanier über das Unglück, welches man ihm hatte verheimlichen wollen.
Der Hauptmann hörte, dass er ihn rief, und ging zu ihm. Er saß mit starren Augen und offenem Mund auf seinen Kissen.
»Tot! Tot!«, stöhnte er.
»Hofft, der Mann täuscht sich vielleicht«, sagte der Hauptmann.
»Tot, sage ich Euch«, flüsterte der Spanier, und nach einer kurzen Pause, als sein Gesicht wieder ruhig geworden war, fügte er hinzu: »Was konnte ich übrigens Besseres hoffen? Sie ist den Misshandlungen der Banditen entgangen und ich werde auch sterben. Glaubt mir, mein Freund, der Tod ist für mich süßer als das Leben, denn er vereinigt mich wieder mit der, die ich mehr als mich selbst liebte.«
Dann legte der junge Mann, als ob er sich zum Sterben vorbereiten wollte, seinen Kopf in die Kissen zurück, zog mit der einen Hand die Decke bis zu den Augen herauf und machte mit der anderen sorgfältig Platz neben sich, als hätte er das Leichenbett derjenigen herstellen wollen, die er nicht mehr wiedersehen sollte. Don Cornelio eilte zu Costal und zog ihn zu dem See.
»Kommt«, flüsterte er ihm zu, »und Ihr werdet sehen.«
Beide erreichten den Ort, von dem das Geschrei ausgegangen war.
Ein weißes, von den Sträuchern zerrissenes, mit Blut und einem grünen Schlamm bedecktes Kleid umhüllte wie ein Totengewand den leblosen Körper einer jungen Frau, welche die Indianer auf ein Schilflager gebettet hatten. Einige grüne Blätter, die ihr Haupt wie ein Totenkranz umrahmten, bildeten ihren letzten Schmuck.
»Sie ist schön, wie die Göttin des Wassers!«, sagte Costal. »Armer Don Mariano«, fügte er hinzu, das Opfer erkennend. »Er ist wohl weit davon entfernt, daran zu glauben, dass er nur eine Tochter hat!«
Er entfernte sich, träumerisch das Haupt gesenkt. Der Hauptmann folgte ihm.
»Nun«, fragte er, »glaubt Ihr noch immer, die Gattin Tlalocs gesehen zu haben?«
»Ich glaube, was meine Väter mich gelehrt haben zu glauben«, erwiderte der Indianer entmutigt. »Ich glaube, dass der Sohn der Kaziken von Tehuantepec sterben wird, ohne den alten Glanz seiner Familie wieder herstellen zu können. Tlaloc hat es nicht gewollt.«
Man wird sich leicht erklären können, wie die junge Frau Don Fernandos aus Furcht vor den Banditen sich bis dahin verirrt hatte.
Am See angekommen, hatten ihr die dichten Schilfhalme, die am Ufer standen, ein passender Zufluchtsort geschienen, in dem sie niemand auffinden würde.
Eben so leicht wird man sich die Anwesenheit Arroyos an demselben Ort erklären können. Der Spur folgend, welche die unglückliche Frau zurückgelassen hatte, war er zu ihrem letzten Zufluchtsort gelangt, indem er wieder seine eigenen Spuren zurückließ, die Don Rafael fand.
Einer der Leute des Guerillero hatte Costal im See schwimmend erblickt, als er im Begriff war, die zu ergreifen, die ihm zufolge seiner tollen Hirngespinste die Göttin der Gewässer zu sein schien. Vor Verlangen brennend, den Tod Gaspachos zu rächen, hatte der Bandit auf Costal gefeuert, aber seine schlecht gezielte Kugel erreichte das unschuldige Opfer, das am Ufer des Sees ein verhängnisvolles Asyl aussuchte und dort seinen Tod fand.
Die plötzliche Gegenwart des unglücklichen Don Fernando an den Ufern des Sees mag vielleicht um so weniger erklärlich erscheinen, da wir den jungen Mann als Gefangenen in seinem eigenen Haus nahe daran, seinen Geist unter den Martern aufzugeben, die sein Henker über ihn verhängte, verlassen hat. Wenige Worte werden auch hier genügen, dem Leser den nötigen Aufschluss zu verschaffen.
Die Frau Arroyos, welche die Eifersucht doppelt scharfsichtig gemacht hatte, war keinen Augenblick über die sträflichen Absichten ihres Mannes in Betreff Doña Marianitas im Unklaren geblieben.
Von dem Gedanken ergriffen, dass Don Fernando, wenn er einmal in Freiheit wäre, vielleicht irgendein Mittel finden würde, seine Frau vor der Lüsternheit des Banditen in Sicherheit zu bringen, hatte sich das Mannweib beeilt, ihn und einige seiner Diener in Freiheit zu setzen, die Übrigen als Geiseln zurückzubehalten.
Außerdem hoffte sie, dass diese Tat, die sie wie eine Handlung der Menschlichkeit betrachtete, den Zorn der Sieger entwaffnen würde.
Eine tragbare Sänfte, in die man Don Fernando schaffte, hatte dazu gedient, ihn aus der Hazienda zu entfernen. Die Indianer, die vor derselben hergingen, waren mithilfe ihrer Fackeln den Spuren gefolgt, welche die junge Frau auf ihrer Flucht hinterlassen hatte, und diese Spuren sowie die zwei aufgefundenen Gegenstände hatten sie natürlich an den See geführt.
Und dort verhauchten fast zu gleicher Zeit der arme Don Fernando und seine unglückliche Gattin ihr Leben, die ihm nur einige Augenblicke ins Jenseits vorangegangen war. Es sind nicht die zu beweinen, die der Tod vereint, sondern nur die, welche er trennt.
»Das ist ein braves Weib«, sagte Veraegui, als er die Freigebung des Spaniers erfuhr. »Deshalb will ich sie auch nur am Hals aufhängen lassen, wäre es auch nur des Anstands wegen.«
Um jede Weitläufigkeit zu vermeiden, fügen wir noch gleich hinzu, dass der Katalonier mit Anbruch des anderen Tages die Hazienda mit stürmender Hand nahm und alle Banditen, mit Ausnahme des Weibes, die am Hals gehängt wurde, an den Beinen aufhängen ließ, sowohl die Toten als auch die Lebenden. Der unerbittliche Leutnant hatte geschworen, seinen ganzen Vorrat an Stricken zu verbrauchen, und er hielt seinen Eid heilig.
Das Schicksal hatte ohne Zweifel die Seele des Vaters gegen das Unglück vorbereiten und stärken wollen, das ihn in einer seiner Töchter traf, indem es ihn zuerst zum Zeugen des unaussprechlichen Glücks derjenigen machte, die es ihm aufbewahrt, sein tröstender Engel zu sein.
Gaspar hatte, als er nach San Carlos ging, um Don Rafael zu suchen, die Plünderung der Hazienda durch die Banditen, die Flucht Marianitas und das grausame Geschick Don Fernandos vernommen und hätte seinen Herrn davon unterrichten können, denn er hatte ihn bei seiner Ankunft am See im Mondschein erkannt. Aber er fürchtete, dass, wenn er sich vor Don Mariano sehen ließe, dieser seinen Befehl, Don Rafael die Botschaft Gertrudis’ zu überbringen, zurücknehmen könnte oder er doch von Neuem aufgehalten würde, war er mitten durch das Gehölz geeilt, um den Ort zu erreichen, wo der Oberst sich befand. Er hatte nur aus Furcht, dass man seine Stimme erkennen würde, unterlassen, auf den Zuruf Juans zu antworten.
Augenblicklich waren die Ufer des Sees, die noch vor Kurzem ein so belebtes Bild darboten, in düsteres Schweigen getaucht und es nahte der Augenblick, in dem sie wieder ihre vorige Einsamkeit erhalten sollten.
Don Cornelio und seine beiden Gefährten waren verschwunden.
Der Leichenzug setzte sich zur Hazienda San Carlos in Bewegung. Ein Tod hatte die Seelen der beiden jungen Gatten vereint, ein und dieselbe Totenbahre sollte auch ihre entseelten Körper wieder vereinigen. Die Indianer, welche sie trugen, schritten schweigend weiter.
Don Mariano, von seinen Dienern begleitet, zu denen sich Gaspar und Juan gesellt hatten, folgte dem Zug. Hinter ihnen kamen in großer Entfernung die Leute aus dem Gefolge Don Rafaels und schlossen zugleich den Zug. Das feierliche Schweigen des Todes herrschte überall.
Nichts verhindert uns jetzt, dem traurigen Bild, welches an uns vorüberzog, das der vollkommenen Glückseligkeit, die dem Menschen zu genießen erlaubt ist, vorzuziehen, die Entzückung einer erwiderten Liebe, der oft lange und grausame Martern vorangehen, die man aber niemals zu teuer erkauft hat.
Nur zwei Personen, die in gleicher Entfernung von Don Mariano und dem Gefolge des Obersten waren, wechselten mit leiser Stimme Worte aus, die kein unberufenes Ohr vernehmen konnte.
Seit ihrer Wiedervereinigung ganz in das Glück versenkt, von welchem ihre Herzen überströmten, waren sie dem, was sich um sie zutrug, vollständig fremd geblieben. Don Mariano, der seinen Schmerz schweigend ertrug, hatte ihnen das doppelte Unglück, welches ihn betroffen, nicht mitgeteilt. Er kannte die innige Zärtlichkeit Gertrudis’ zu ihrer Schwester und musste fürchten, ihr den Todesstreich zu versetzen, wenn er in dem Zustand der Schwäche, in dem sie sich befand, sie mit dem traurigen Ende Marianitas bekannt gemacht hätte, ohne sie darauf vorzubereiten.
Don Rafael, der zur Seite der Sänfte ritt, neigte sich aus seinem Sattel, um kein Wort aus ihrem Munde zu verlieren, und fing jeden ihrer Laute mit der Gier des Wanderers auf, den der Durst aufreibt und der sich endlich über die Quelle, nach der er so lange schmachtete, neigen und in vollen Zügen das klare, frische Wasser einschlürfen kann.
Das unbestimmte Licht, welchem die halb geschlossenen Vorhänge kaum Eingang in die Sänfte gestatteten, erlaubte Don Rafael nur die unbestimmten Umrisse von Gertrudis’ Gesicht zu erkennen. Dieses, dem jungen Mädchen so günstige Halbdunkel diente auch dazu, ihre Verwirrung und das Glück, welches das hohe Rot verriet, das ihre bisher so bleichen Wangen bedeckte, zu verbergen. Von der Heftigkeit ihrer Leidenschaft erschöpft, warf sie heimliche Blicke auf den Geliebten, um sich zu überzeugen, ob der Schmerz der Trennung auch auf seinem Gesicht Spuren zurückgelassen habe.
Zwar hatte die unauslöschliche Liebe, von der er verzehrt wurde, seit langer Zeit die Spuren einer tiefen Schwermut auf seinem Gesicht kenntlich gemacht, in diesem Moment strahlte es von Glück, weil Don Rafael nicht mehr an der Liebe Gertrudis’ zweifelte, obwohl diese noch Zweifel in die seine setzte.
Das junge Mädchen seufzte und dennoch hätte diese unwandelbare Liebe, deren Ausdruck sie bei den letzten Strahlen des scheidenden Mondes in jedem Gesichtszug ihres Geliebten wahrnehmen konnte, sie über ihren Argwohn beruhigen müssen.
»Ich kann Ihnen nicht glauben, Rafael«, sagte sie. »Was aber die Aufrichtigkeit meiner Worte betrifft, so werden Sie nicht daran zweifeln, nicht wahr? Denn diese Botschaft sagt Ihnen schon deutlich, dass ich ohne Sie nicht mehr leben konnte. Sie sind nun gekommen – o, Rafael«, fügte sie mit einem Schluchzen schmerzlichen Glückes hinzu, »was wollen Sie mir anführen, um auch mich zu überzeugen, dass Sie mich immer geliebt haben?«
»Welchen Beweis ich dafür beibringen will? Keinen Einzigen, Gertrudis. Sie haben von mir den feierlichen Eid empfangen, dass, wenn ich auch den Dolch über meinen ärgsten Todfeind gezückt hätte, mein Arm gehoben bleiben sollte, ohne den tödlichen Streich auszuführen, um Ihrer Botschaft zu folgen. Ich bin gekommen und stehe vor Ihnen.«
»Sie sind großmütig, ich weiß es, Rafael, aber – Sie hatten es geschworen – ach, mein Gott!«, rief Gertrudis erschreckt, »was höre ich?«
Ein entsetzlicher Hilferuf gellte über die Ebene und brach sich an den Felsen des Monapostiac mit grausigem Echo.
»Es ist nichts«, erwiderte Don Rafael, »es ist die Stimme Arroyos, eines der Mörder meines Vaters, auf dessen noch blutiges, vom Rumpf getrenntes Haupt ich geschworen habe, das Ungeheuer auf Leben und Tod zu verfolgen. Still, Gertrudis, fürchten Sie nichts«, fiel er ein, um auf eine neue Gebärde des Schreiens zu antworten, die sie dabei machte. »Der Bandit liegt dort geknebelt am Boden. Jetzt hatte ich ihn eben in meiner Gewalt, den Mann, den ich seit zwei Jahren unablässig verfolgt habe, da kam Ihre Botschaft. Ich zerschnitt darauf die Bande, die den Räuber und Mörder an dem Schweif meines Pferdes festhielt. Um so schneller zu Ihnen gelangen zu können.«
Gertrudis ließ halb ohnmächtig ihren Kopf auf die Kissen zurückfallen und sagte, als Don Rafael sich erschreckt zu ihr niederbeugte, mit ersterbender Stimme: »Ihre Hand, Rafael, für das namenlose Glück, das Sie mir bereitet!«
Und Don Rafael fühlte, vor Glück zitternd, den Druck ihrer Lippen auf seiner Hand, die er ihr gereicht hatte.
Dann zog Gertrudis, beschämt über diese Offenbarung ihrer Leidenschaft, plötzlich die Vorhänge der Sänfte zusammen, um in der Dunkelheit unter dem Auge Gottes allein die höchste Glückseligkeit zu genießen, die, sich geliebt zu sehen, wie sie selbst liebte, eine Glückseligkeit, die ihr zwar fast das Herz sprengte, von der sie aber fühlte, dass sie ihr das Leben verdanke.
Die verschiedenen Personen, die wir im Verlaufe der Erzählung haben leiden, lieben oder kämpfen sehen, Fernando und Marianita ausgestreckt auf der Leichenbahre. Gertrudis in ihrer Sänfte wieder zum Leben genesend, Don Rafael, Don Mariano und sein Gefolge, alle entfernten sich nach und nach vom Schauplatz, wie die Bilder, die uns manchmal die Phantasie verzaubert oder die Träume vor unseren Augen vorübergleiten lassen und die dann allmählich vor unseren Blicken erlöschen. Don Cornelio, Clara und Costal waren, wie wir früher gesagt haben, schon verschwunden und der letzte Reiter im Gefolge Don Rafaels, der den Trauerzug schloss, wurde auch hinter dem Zedernvorhang unsichtbar, der den See im Westen begrenzte.
Nur zwei regungslose Körper blieben allein an den verödeten Ufern des Sees zurück, der eine, leblos niedergestreckt, war Bocadro, der andere noch lebende Arroyo, bestimmt, je nachdem seine Stunde geschlagen hatte oder nicht, den Geiern zur Nahrung zu dienen, seine verbrecherische Seele unter dem Dolch eines Royalisten auszuhauchen oder das Mitleid eines Insurgenten zu rühren.
Der Mond war hinter der Hügelkette verschwunden und die glasartige Durchsichtigkeit, die dem verzauberten Hügel ein Scheinbild des Lebens verliehen hatte, war erloschen. Seine Strahlen beleuchteten nur noch die Gewässer des Sees.
Der Monapostiac und der See Ostuta hatten, der eine seinen melancholischen Ausdruck, der andere seine finstere, beängstigende Ruhe wieder angenommen.


