Der Schwur – Dritter Teil – Kapitel 10
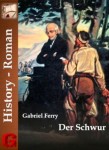 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Dritter Teil
Der See Ostuta
Kapitel 10
Die Botschaft
Von dem Augenblick an, wo wir Costal und Clara verlassen haben, als sie das Schilf des Seeufers zerteilten, um die Kaimane daraus zu verjagen, und sich dann in seine schlammigen Wasser stürzten, beide von dem blinden Fatalismus des Indianers fortgerissen, der ihn der Alligatoren mit derselben Unerschrockenheit trotzen ließ, mit, der er der Haifische getrotzt hatte, ist der Leser vollständig im Ungewissen, was aus diesen beiden Personen geworden ist. Wir führen sie auf den Schauplatz zurück, wohin es überhaupt nötig sein wird, ihnen einige Momente zu folgen, um erklären zu können, wie das Phantastische dem wirklichen Drama als Einleitung gedient hat, dessen Entwicklung wir entgegengehen.
Als die beiden Abenteurer in dem Schatten, welchen der verzauberte Hügel warf, verschwunden waren, beeilten sie sich, wie der Hauptmann ganz richtig vermutet hatte, den Hügel selbst zu besteigen.
Der Monapostiac ist weiter nichts, als ein ungeheurer Block von schwärzlichgrünem Obsidian, der aus langen, senkrechten und unregelmäßigen, jedoch voneinander stetig geschiedenen Schichten gebildet ist. Das ist die Ursache der Spalten, die man in seinen Hängen sieht. Wird diese glasartige Masse von den Sonnen- oder Mondstrahlen beschienen, so erhält er eine Art trüber Durchsichtigkeit, die im Verein mit dem dichten Nebel, der den Gipfel des Hügels bedeckt, einen fremdartigen und melancholischen Gesamteindruck hervorruft.
Gewisse Teile dieses Felsenblocks, die Costal ganz genau kannte, erzeugen einen wunderbaren mystisch-hellen Klang, der für Don Cornelio und Don Mariano sowie für dessen Leute, von so besonderer Wirkung gewesen war.
Bald ganz diesen Betrachtungen hingegeben, bald aber mit leiser Stimme Gebete in der Sprache seiner Väter murmelnd, harrte der Indianer auf den Zeitpunkt, in dem der Mond sich über dem Vorhang von Zedern zeigte, der die Ebene abschloss, um seine Beschwörung zu beginnen.
Es würde zu lang und zu ermüdend sein, dem Leser alle die komischen Zeremonien vorzuführen, mit deren Hilfe der Indianer den mächtigen Geist beschwor, dessen Erscheinen endlich dem Nachkommen der Kaziken von Tehuantepec den Glanz seiner Familie wieder herstellen sollte.
Wenn Beharrlichkeit und Mut von den indianischen Gottheiten die Gunst, die er erflehte, hätte erlangen können, so hatte sie Costal gewiss im vollen Maß verdient. Obwohl bis zu diesem Augenblick nichts anzeigte, dass Tlaloc oder Matlacuezc ihrem beherzten Verehrer erscheinen würden, glänzte doch das Gesicht Costals in so freudiger Hoffnung, dass der Schwarze keinen Moment zweifelte, diesen letzten Versuch vom besten Erfolg gekrönt zu sehen.
Seit dem so ungeduldig erwarteten Aufgang des Mondes war mehr als eine Stunde mit Vorbereitungen aller Art vergangen, als Costal endlich das feierliche Schweigen, welches er bis dahin gegen Clara vorbrachte, brach.
»Clara«, sagte er mit ernster Stimme, »wenn die Götter meiner Väter, von dem Sohn der Kaziken, der fünfzig Regenzeiten gesehen, gerufen, die Töne hören werden, auf die sie vor drei Jahrhunderten lauschten, so werden sie ohne Zweifel erscheinen.«
»Ich hoffe es auch«, sagte Clara.
»Ja! Wer weiß, ob es Tlaloc oder seine Gefährtin sein wird?«
»Das kümmert mich wenig.«
»Matlacuezc«, nahm der Indianer wieder das Wort, »ist in ein so klares Weiß gekleidet, wie das der Blume der weißen Seerose, wenn ihr Haar nicht auf den Kopf gewunden ist, fällt es auf ihr Kleid herab, wie die Mantille einer Dame von hohem Stand. Ihre Augen sind glänzender als die Sterne und ihre Stimme sanfter als die des Spottvogels, wenn er die Melodien der Nachtigall nachahmt, und dennoch ist ihr Anblick schrecklich zu ertragen.«
»Ich werde ihn ertragen«, sagte der Afrikaner.
»Tlaloc hat einen riesenhaften Wuchs, zusammengerollte Schlangen zischen in seinem Haar, sein Auge ist wie das Auge des Jaguars, seine Stimme rollt wie die zweier Stiere. Überlegt, solange es noch Zeit ist.«
»Ich habe es Euch gesagt, ich will Gold, und ich kümmere mich wenig darum, ob es Tlaloc oder seine Gefährtin ist, die mir es gibt. Bei allen christlichen und heidnischen Teufeln! Ich bin nicht bis hierher gegangen, um nun zurückzutreten.«
»Nun«, fuhr Costal fort, »so will ich meine Götter anrufen.«
Mit diesen Worten ergriff der Indianer einen neben ihm liegenden Stein und schlug, zu dem Hügel gehend, damit stark an eine der hervorspringenden Ecken. Der Schlag schallte weithin, gleich dem Klang des Erzes. Elf Mal noch wiederholte er seine schreckliche Beschwörung.
Ein anfangs noch unbestimmtes Gemurmel schien den Schlägen zu antworten. Bald darauf aber erschallte, als ob Costal die Macht gehabt hätte, die schreckliche Stimme Tlalocs zu beschwören, fürchterliches Geheul und unterbrach die Stille des Waldes. Es war dies dasselbe Geheul, welches auch den Hauptmann und die Leute Don Marianos so sehr in Schrecken gesetzt hatte.
Clara war eine Beute eben dieses Schreckens, dies dauerte nur einen Moment, denn er rief gleich darauf mit fester Stimme: »Läutet noch einmal, Costal, Tlaloc hat geantwortet.«
Der Indianer warf auf Clara einen forschenden Blick. Der Mond zeigte den grauschwarzen Teint seines Gesichts. Es war augenscheinlich, dass der Schwarze im Ernst sprach.
»Ei was«, sagte Costal, »seid Ihr denn so wenig mit den Geheimnissen des Waldes vertraut, dass Ihr die Stimme eines ekligen Tieres mit der des Gottes der Berge verwechselt?«
»Ein Tier heult, so?«
»Ohne Zweifel; diese Stimme ist zwar schreckenerregend, nur für die, die das Tier nicht kennen, von dem dieselbe herrührt.
Das ist die Stimme des Brüllaffen, den Ihr mit einem Schlag Eurer Reitpeitsche, die Ihr am Sattelknopf gelassen habt, töten könntet. Nein, nein, die Stimme Tlalocs ist viel schrecklicher.«
»Nun, es tut mir leid«, antwortete der Afrikaner.
Bald verlieh der Anblick der Reiter, welche die Umgegend des Sees durchsuchten, ihren Gedanken eine andere Richtung. Die Banditen Arroyos waren kaum hinter dem Schilf verschwunden, als aus der dichten Stelle des Ufergebüsches die weiße Erscheinung auftauchte, die der Hauptmann noch mit Schauer anstarrte.
Beim Anblick dieser plötzlichen Erscheinung erglänzte im Auge des unerschrockenen Costal ein Blitz des Triumphs. Er ergriff mit einer Hand den Arm seines Gefährten.
»Die Zeit ist gekommen«, sagte er, »der Glanz der Kaziken von Tehuantepec wird wiedererstehen. Sieh!«
Er zeigte mit der anderen Hand auf eine weiße Frauengestalt mit wallendem schwarzen Haar, welche der Mond mitten im Schilf beleuchtete.
»Das ist Matlacuezc«, erwiderte der Afrikaner mit leiser Stimme.
Obwohl sein Herz mit verdoppelten Schlägen in seiner Brust pochte, ließ Clara doch den geheimen Schrecken nicht erraten, den er der Gottheit gegenüber empfand, die sich endlich seinen Blicken darbot.
Beide stiegen geräuschlos vom Felsen in das Wasser und schwammen zum Ufer.
In diesem Augenblick verschwand die weiße Erscheinung und die beiden Abenteurer verloren sie aus dem Blickfeld, obwohl der Hauptmann von der Höhe seines Verstecks, das er innehatte, sie noch hinter dem grünen Saum der Schwertlilien gekauert erkennen konnte.
Der Indianer hatte die Richtung nicht verloren und sein kräftiger Arm teilte das Wasser so schnell, dass der Afrikaner, so sehr er sich auch anstrengte, zehn Längen hinter ihm zurückblieb.
Bald darauf sah Lantejas, dem vor dem übermenschlichen Mut Costals schauerte, ihn seine Arme ausstrecken, um sich der Göttin des Wassers zu bemächtigen, als eine Stimme rief: »Nicht auf den Schwarzen! Zuerst auf den Mörder Gaspachos!«
Ein Schuss furchte den See. Don Cornelio verlor den Schwarzen und denn Indianer aus den Augen, die untergetaucht waren. An dem Ort, den Costal eben verlassen hatte, sah er das Schilf sich schwankend bewegen. Er hörte etwas wie einen leisen Todesschrei, die Schwertlilien hörten auf zu rauschen und der Schrei erstarb.
Die Erscheinung im weißen Kleid und mit dem fliegenden Haar war verschwunden. Der See blieb öde, doch nur für einen Augenblick.
Costal und Clara erschienen wieder auf der Oberfläche und erreichten schleunigst das Ufer, einen Büchsenschuss vom Hauptmann entfernt.
Das wirkliche Drama mischte sich so eng mit dem phantastischen Anschein, dass Don Cornelio einen Augenblick lang verwirrt blieb und ihm das Gesicht wie von Wolken verhüllt schien.
Der Anblick der Gefahr, in der seine beiden treuen Gefährten schwebten, vermochte allein, ihn wieder zu sich zu bringen und ihm zu zeigen, dass das, was sich unter seinen Augen zutrug, mehr als ein Traum war.
Zwei Leute Arroyos, die plötzlich hinter dem Schilf, in geringer Entfernung von dem, Ort, wo die Erscheinung sich für einen Augenblick gezeigt hatte, hervorsprangen, verfolgten Clara und Costal mit dem Degen in der Faust.
Bei diesem Anblick erhielt der Hauptmann seine Besinnung wieder. Er legte den Lauf seines Karabiners auf einen Zweig und gab Feuer. Einer der Banditen stürzte, der andere blieb erschreckt von diesem unerwarteten Schuss stehen.
Diese Verzögerung gab den beiden Abenteurern Zeit, zu ihren Pferden zu gelangen und sich wie zwei Gespenster, vom Wasser des Sees triefend, in den Sattel zu schwingen.
Auch der Hauptmann stieg eilig vom Baum, indem er seinen Namen nannte und seine beiden Gefährten bei den ihren rief.
»Ah«, rief Costal, »ich hatte schon Besorgnis, indem ich Euer Pferd erkannte, dass Euch irgendein Unglück zugestoßen sei.«
Der Bandit, der allein geblieben war, ergriff während dieser Zeit die Flucht und eilte zu dem Ort hin, wo er sein Pferd unter der Aufsicht seiner Gefährten gelassen hatte. Er wurde doch von dem Indianer, der ihn in einigen Sätzen eingeholt hatte, niedergeritten, von den Hufen des Pferdes zertrampelt und von jenem noch durch einen Degenstoß an die Erde geheftet, ohne dass er den Sattel verlassen hätte.
»Jetzt schnell zum See!«, rief Costal, lebhaft sich an den Schwarzen wendend. »Ihr könnt uns in diesem Gehölz erwarten, Señor Don Cornelio. Wir müssen durchaus allein sein.«
Als er den Fuß schon auf die Erde setzte, veränderte ein neuer Zwischenfall die Lage der Dinge.
Fünf Reiter und eine von zwei Maultieren getragene Sänfte wurden plötzlich am Ufer des Sees, fast am äußeren Ende des Waldes sichtbar. Es waren dies Don Mariano an der Seite der Sänfte seiner Tochter und seine vier Diener.
Don Mariano hatte gehört, dass der Hauptmann Lantejas seinen Namen nannte, indem er Costal und Clara bei dem ihren rief, und beeilte sich voll froher Zuversicht über die unerwartete Verstärkung, die der Himmel ihm sandte, sie zu erreichen.
Von der anderen Seite des Sees brach in demselben Moment hinter der Zedernreihe eine zweite Truppe zu Pferd hervor, die ungefähr aus einem halben Dutzend flüchtiger Männer bestand, die allem Anschein nach von einer gleichen Anzahl Reiter, die ihrerseits mit geschwungenen Säbeln erschienen, verfolgt wurde.
»Was ist das«, schrie Costal, wie ein Heide fluchend, der er auch in Wirklichkeit noch war, »dass diese Eindringlinge kommen und die Verehrer Tlalocs stören?«
Der Afrikaner, der in diesem Augenblick seinen und Costals Namen rufen hörte, schlug sich die Brust vor Verzweiflung, indem er an die unwiederbringlich verlorene Gelegenheit dachte, die ihm dieser plötzliche Überfall des vorher so stillen Sees aus den Händen gewunden hatte. Es war die Stimme Don Marianos, welche man hörte. Er gab sich zu erkennen und nannte auch den Hauptmann Lantejas bei seinem Namen, ohne aber zu wissen, dass es derselbe sei, der den Vornamen Cornelio führte und der früher ein Gast der Hazienda las Palmas gewesen war.
»Jawohl, das bin ich, so wahr Gott lebt!«, erwiderte der Hauptmann, im höchsten Grad erstaunt, hier mitten in dieser bisher so traurigen Einsamkeit Bekannte zu finden.
Während dieser verschiedenen Zwischenfälle schienen die Flüchtlinge nicht recht zu wissen, wohin sie sich wenden sollten. Bald schlugen sie, indem sie wahrscheinlich nicht die am Saum des Waldes versammelte Gruppe bemerkten, die Richtung nach dorthin ein.
Lantejas und seine beiden Gefährten sowie Don Mariano und seine Leute behielten nur noch eben so viel Zeit, um sich schleunigst hinter den Bäumen zu decken, damit sie durch den stürmischen Galopp der Pferde, die mit verhängten Zügeln auf sie zusprengten und wie ein Wirbelwind an ihnen vorübersausten, nicht niedergetreten wurden.
Ungeachtet der Schnelligkeit, mit der sie vorüberhuschten, hatte doch das durchdringende Auge Costals unter den Flüchtlingen zwei Männer erblickt, die er nie verkennen konnte, denn sie waren wie er Diener Don Marianos gewesen.
»Wir sind in Feindesland«, sagte er mit leiser Stimme zu Clara. Da sind Arroyo und Bocadro. Sie werden ohne Zweifel von den Royalisten verfolgt.«
Er hatte kaum seinen Satz vollendet, als die sechs auf der Verfolgung Arroyos befindlichen Reiter in einem nicht minder wütenden Galopp wie der Blitz an ihnen vorüberjagten.
Einer von ihnen, soviel man beurteilen konnte, von hoher Gestalt, war seinen fünf Gefährten ein Stück voraus. Auf den Hals seines Pferdes niedergebeugt, schien er eher zu fliegen, als zu reiten, und dennoch stieß er seinem Tier ohne Unterlass die Sporen in die Weichen.
Indem er krampfhaft seinen schwarzen breitkrempigen Hut, der ihm bei der Schnelligkeit des Ritts beinahe vom Kopf geflogen wäre, ergriff, drückte er ihn derart auf den Kopf, dass sein schon halb von der Mähne seines Pferdes verdecktes Gesicht fast ganz unsichtbar wurde. Der Renner selbst machte in demselben Augenblick, entweder von der dunklen Masse der Sänfte Gertrudis oder durch irgendeinen anderen Gegenstand erschreckt, einen Seitensprung und stieß aus seinen Nüstern ein fremdartiges und raues Schnaufen aus, welchem ein schwacher, unter den Vorhängen der Sänfte hervordringender Schrei antwortete.
Dieser Schrei ging ungehört an dem Reiter vorüber, der nicht einmal den Kopf umwandte.
Gertrudis war nicht die Einzige, die bei diesem so leicht kenntlichen Schnauben erzitterte. Auch Don Cornelio erinnerte sich, dasselbe in schrecklicher Weise hinter sich gehört zu haben, und zwar auf dem Schlachtfeld von Huajapam, wenige Augenblicke früher, als er sich von dem kräftigen Arm des Obersten Tres-Villas aus dem Sattel gerissen fühlte.
Don Mariano hatte nicht die Eigentümlichkeit eines Pferdes erkennen können, das solange in seinem Stall gestanden.
Der Reiter besaß auch den hohen Wuchs Don Rafaels. Sollte er es sein, er, den man bei der Belagerung Huajapams vermutete. Noch konnte man daran zweifeln.
Costal und Clara hatten, indem sie sich vornahmen, ihre Beschwörungen zwar fortzusetzen, denn diese Nacht war noch nicht zu Ende, dies aber auf eine günstigere Stunde zu verlegen, sich auf den Weg gemacht, ihre Schusswaffen und Kleidungsstücke wiederzuholen. Don Cornelio blieb so lange allein mit seinem früheren Wirt und dessen Tochter.
Da man in vollständiger Ungewissheit schwebte, was man anfangen sollte, so erwarteten alle mit einer gewissen Beklemmung das Ende des Gefechts, welches fast vor ihren Augen stattfinden musste, dessen Einzelheiten ihnen aber durch die Entfernung, ungeachtet des Lichtes, den der Mond auf den See warf, dessen Ufer den Schauplatz bildeten, auf dem die Entscheidung eintreten musste, entgingen.
Don Rafael, der seit der Zeit, wo wir ihn die Hazienda San Carlos haben verlassen sehen, sich immer mehr dem See Ostuta genähert hatte, ließ in seiner erbitterten Verfolgung nicht nach.
Von Minute zu Minute wurde der Raum, der ihn von Arroyo noch trennte, kleiner, und der Bandit, der trotz seiner gewöhnlichen Tapferkeit von einem wahnsinnigen Schrecken vor dem unerbittlichen und furchtbaren Feind, dem er zu entfliehen strebte, ergriffen zu sein schien, konnte es sich nicht verbergen, dass der schreckliche Arm des Obersten ihn bald erreichen musste.
Nichtsdestoweniger hatte er einen Augenblick Hoffnung, denn die Soldaten im Gefolge Don Rafaels waren nicht so gut beritten wie ihr Anführer, der ihnen vier bis fünf Pferdelängen voraus war. Der Bandit konnte seine Begleiter eine Frontschwenkung machen und Don Rafael umzingeln lassen, bevor dessen Reiter Zeit hatten, ihn zu erreichen. Aber sein Mut war gebrochen und so entging ihm diese letzte Aussicht auf Rettung. Die unbändige Kraft des Obersten und sein blinder Mut waren ihm zu sehr bekannt, um hoffen zu können, ihm den Garaus zu machen in einem so kurzen Zeitraum, als dazu nötig war, dass seine Leute ihm zur Hilfe kommen konnten.
Arroyo war an das äußere östliche Ende des Sees gekommen. In geringer Entfernung vor ihm breiteten sich die unermesslichen Ebenen aus, in denen er sich schmeichelte, den Verfolgungen seines Feindes entgehen zu können. Er sprengte daher in der Richtung fort, fest entschlossen, nur im äußersten Notfall von dem gefährlichen Mittel einen Gebrauch zu machen, das ihm der Vorsprung des Obersten gewährte.
Don Rafael folgte trotz seiner flammenden Leidenschaften aufmerksam jeder Bewegung seines Feindes. Der schien seine Absicht zu erraten, denn seit einigen Sekunden hatte er sich schon von der Krümmung, die der See machte, entfernt, um ihm alle Hoffnung auf einen Rückzug zu seiner Rechten abzuschneiden. Indem Arroyo, dem Bocadro dicht auf dem Fuß folgte, einen plötzlichen Seitensprung machte, war es schon zu spät.
Das Pferd sprengte, sein raues Schnauben ausstoßend, mit seinem Reiter in gleicher Linie mit den beiden Banditen. Schnell warf Arroyo sein Pferd nach links herum. Das war es aber, was Don Rafael erwartete, der mit ihm dieselbe Absicht zu haben schien, die der Jäger mit dem Hirsch hat, dem, von den Hunden gehetzt, nur noch als Rettungsmittel der Teich übrig bleibt, zu dem er getrieben wird.
»Sieh dich vor!«, schrie Bocadro seinem Gefährten beim Anblick des Obersten zu, der mit einer plötzlichen Anstrengung an ihm vorübergesprengt war und sich auf Arroyo stürzte.
Arroyo feuerte seine Pistole ab, die er in der Hand hatte, und zog dabei unwillkürlich den Zügel seines Pferdes an. Der Schuss, der schlecht gezielt war, traf niemanden, dessen Pferd, indem es mit der Brust gegen die Seite von Arroyos Pferd rannte, dasselbe über den Haufen warf.
Bocadro warf sich zwischen beide, um seinem Gefährten Zeit zu verschaffen, sich wieder zu erholen.
»Fort, unreiner Iltis!«, schrie der Oberst, indem er ihn durch einen Schlag mit seiner Säbelscheide aus dem Sattel warf.
Arroyo, von dem Sturz verwundet und zerquetscht, mit den Sporen unter dem Sattel verwickelt, machte vergebliche Anstrengungen, sich zu erheben, als schon der Oberst von der einen, seine Leute von der anderen Seite ihn mit gezückten Säbeln umringten, während die vier Insurgenten mit verhängten Zügeln davoneilten und Bocadro mit gebrochenen Rippen unbeweglich auf dem Sand lag.
Die Zuschauer hatten von dem Fleck, wo sie standen, diesen doppelten Sturz gesehen, ohne wegen der großen Entfernung erraten zu können, auf wessen Seite der Vorteil war.
Für den Fall, wenn nur die Ufer des Sees wieder einsam würden, kümmerte dies Clara und Costal wenig. Dasselbe war nicht mit Don Mariano der Fall.
Von dem Gedanken verfolgt, dass einer der Teilnehmer an diesem blutigen Kampf der Oberst Tres-Villas sein könnte, dessen Leben ihm jetzt so kostbar geworden war, da sozusagen das Leben seiner Tochter an dem seinen hing, war Don Mariano in schmerzliche Ungewissheit versunken und hatte von Beginn der fürchterlichen Szene an, die sich vor seinen Augen zutrug, das tiefe Schweigen bewahrt.
Ein lebhaftes Gefühl der Neugierde hatte auch Don Cornelio und seine beiden Gefährten stumm gemacht. Don Mariano wusste also noch nicht, dass die Hazienda San Carlos von der Bande Arroyos genommen und geplündert worden war, und auch Gertrudis, deren Ohr begierig das den Nüstern des Roncador entschlüpfte Schnauben eingesogen hatte, war in ihrer tödlichen Furcht hinter den Vorhängen der Sänfte in tiefes Schweigen verfallen.
Costal war der Erste, der dieses lange Schweigen brach, von Verlangen getrieben, sich mit Clara wieder allein am Ufer des Sees zu sehen.
»Wie es auch immer kommen mag«, sagte er, »die Straße ist jetzt frei und der Señor Don Mariano kann ruhig seinen Weg fortsetzen, wenn er zur Hazienda las Palmas will.«
»Wir gehen nicht nach las Palmas«, erwiderte Don Mariano zerstreut, einige Schritte vorgehend, wie um zu erspähen, was sich zutrage, ohne dass das verworrene Geräusch von Stimmen, welches er in einiger Entfernung von sich hörte, seine Zweifel lösen konnte.
»An Eurer Stelle würde ich nicht zögern, meinen Weg wieder anzutreten«, sagte Costal. »Die Augenblicke sind kostbar. Bei allen Schlangen des Hauptes Tlalocs!«, rief er dann mit einem von Zorn gemischten Staunen aus, »es ist noch einer im Wald!«
Man konnte in der Tat ganz in der Nähe das Krachen des Gesträuchs und der Lianen hören.
Dann wurden folgende Worte ganz deutlich ausgesprochen: »Hierher, Gevatter, hierher! Ich höre da, die Stimme dessen den wir suchen. Schnell, bei allen Teufeln, damit er uns diesmal nicht wieder entschlüpft!«
Diese Stimme war keinem von denen bekannt, die sie hörten. Der Mann, zu dem sie sprach, war noch nicht sichtbar geworden. Das Geräusch der Schritte verlor sich nach und nach und erstarb in der Ferne.
Der Mond, der bald hinter den Hügeln verschwand, beleuchtete mit seinen schrägen Strahlen noch eine Gruppe Männer und Pferde, deren Schatten sich übermäßig in dem weißen Sand der Ebene verlängerten. Was ging jedoch mitten in dieser Gruppe vor? Eine schreckliche Szene ohne Zweifel, wenn man nach einem ausgestoßenen furchtbaren Schrei urteilen durfte, der dem Besitzer der Hazienda das Herz durchschauerte.
War es der besiegte Don Rafael, der diesen Schrei ausstieß, oder übte er selbst einen Akt unerbittlicher Justiz an dem Mörder seines Vaters?
In dem Augenblick, wo Arroyo sich unter der Last seines Pferdes abarbeitete, war Don Rafael von dem seinen gesprungen. Seine beiden Eisenfäuste umspannten die Arme Arroyos, während er den Dolch zwischen den Zähnen hielt. Vergebens versuchte der Bandit, sich mit seinen gebrochenen Knochen den tödlichen Umschlingungen zu entziehen. Dann stemmte Don Rafael mit dem ganzen Gewicht seines Körpers ein Knie auf seine Brust, ein Knie, so schwer, als wenn ein Felsblock, der vom Monapostiac heruntergerollt, auf seiner Brust lagerte. Arroyo, dem Schmerz unterliegend, blieb mit ausgestreckten Armen unbeweglich am Boden, während Wut und Schrecken in schnellem Wechsel sich auf seinem Gesicht malten.
»Knebelt ihn!«, herrschte Don Rafael. Mit Blitzesschnelle schlang sich das Lasso einer seiner Reiter zehn Mal um die Beine und Arme des am Boden liegenden Banditen.
»Gut«, sagte der Oberst, als Arroyo jeder Möglichkeit beraubt war, noch irgendeine Bewegung zu machen. »Befestigt ihn an dem Schweif des Roncador.«
Wie sehr auch die spanischen Soldaten an die furchtbaren Racheakte gewöhnt sein mochten, die fast jedem Sieg auf der einen wie auf der anderen Seite folgten, so führten sie diesen Befehl doch nur unter tiefem Schweigen aus.
Als das äußere Ende des Lassos, mit dem man den Banditen gebunden hatte, an der Schwanzwurzel des Roncador, der ebenfalls die blutige Arbeit, womit man ihn belud, ungern verrichten zu wollen schien, befestigt worden war, schwang sich der Oberst in den Sattel.
Er warf einen Blick voller Hass auf den Mörder seines Vaters. Ein Hohngelächter antwortete dem Geschrei Arroyos um Gnade.
»Wohin wird das führen?«, fragte er.
»Antonio Valdes ist auch so gestorben, und du wirst sterben wie er. Ich habe es dir in der Hazienda las Palmas gesagt.«
Die Sporen des Obersten erklangen mit dumpfem Geklirr gegen die Weichen Roncadors, das Tier bäumte sich heftig in dem Augenblick, als der Bandit den Angst- und Schmerzensschrei ausstieß, der Don Mariano so heftig ergriffen hatte.
Bei einem zweiten Sporenstoß ließ der Roncador ein heiseres Wiehern hören, machte einen Sprung vorwärts und blieb dann unbeweglich und zitternd stehen. Arroyo, mit Heftigkeit vom Boden aufgerissen, fiel schwerfällig wieder zurück.
In diesem Augenblick liefen zwei Männer fast außer Atem herbei.
Der Mond beleuchtete das Gesicht des Obersten wie am hellen Tag.
Sobald die Männer ihn erreicht hatten, rief einer derselben: »Einen Augenblick, Herr Oberst, im Namen Gottes! Geht nicht wieder fort, wir haben zu viel erdulden müssen, um Euch aufzufinden, mein Gevatter nämlich und ich.«
Der Mann, der so sprach, zog den Hut und zeigte die militärische Physiognomie des uns bekannten Juan el Zapote, während der ehrliche Gaspar ihn atemlos erreichte.
Der Oberst konnte die beiden Genossen seiner Gefahren in dem Wald an den Ufern des Flusses erkennen, noch hatte er vergessen, dass einer von beiden ihm einen heilsamen Rat gegeben, indem er ihm den Ort genannt, wo er eine sichere Zuflucht gefunden hatte.
»Was wollt Ihr?«, fragte er sie. »Seht Ihr nicht, dass ich keine Zeit habe, Euch anzuhören?«
»Ja, ohne Zweifel, wir sind zudringlich! Ei, seht doch, das ist der Hauptmann Arroyo, mit dem Ihr Euch ein bisschen beschäftigt! Wir laufen Euch aber unausgesetzt seit vierundzwanzig Stunden nach und immer entwischt Ihr uns. Ich habe eine Botschaft auf Leben und Tod für Euch.«
»Gnade! Gnade! Herr Oberst!«, rief Arroyo mit jammernder Stimme.
»Still doch!«, sagte Juan. »Ihr behindert uns am Sprechen.«
»Eine Botschaft?«, rief der Oberst, dessen Herz in süßer Hoffnung erbebte. »Eine Botschaft? Und von wem?«
»Lasst Eure Mannschaft sich entfernen«, erwiderte Juan. »Es ist eine Botschaft vertraulicher Natur – eine Liebesbotschaft«, setzte er leise hinzu.
Auf eine befehlende Bewegung des Obersten, denn die Stimme versagte ihm augenblicklich, entfernten sich seine Reiter so weit, dass sie nichts mehr hören konnten, und dennoch neigte Don Rafael, als ob ihm diese Vorsicht noch nicht genüge, den Kopf zu dem Boten nieder.
Was sagte ihm Juan, der, nachdem er sich so geschickt für Gaspar eingeführt hatte, auch allein die Rolle des wahren Boten spielte? Wir können wohl unterlassen, es hier mitzuteilen. Das Benehmen des Obersten allein ließ genugsam den Sinn der Worte erraten, welche er hörte.
Mit der einen Hand auf die lange Mähne des Roncador wie auf einen Haltepunkt gestürzt, dessen er benötigt war, um sich im Sattel zu halten, unterdrückte der Oberst mühsam einen leidenschaftlichen Ausruf des Entzückens. Dann verbarg er hastig einen Gegenstand, den ihm der Bote überreichte, der seinerseits wieder auf ein Wort Don Rafaels einen bewunderungswürdigen Luftsprung zum Zeichen seiner ausgelassenen Freude machte.
Dann zog der Oberst seinen Dolch und seine Reiter konnten ihn mit leiser Stimme zu Juan sagen hören: »Gott wollte noch nicht, dass dieser Mann stürbe, weil er Euch in diesem Augenblick zu mir gesandt hat.« Und vergessend, dass er nun endlich seinen ärgsten Feind, den Mörder seines Vaters, in seiner Gewalt habe, vergessend seiner Rache schmähe, um sich nur noch unter den köstlichen Gefühlen, die sein Herz erfüllten, an den Schwur der Verzeihung zu erinnern, den er vor Gertrudis selbst abgelegt hatte, neigte sich Don Rafael auf die Kruppe seines Pferdes und durchschnitt die Bande, welche den Elenden, dem die unerwartete Ankunft Juans das Leben rettete, an sein Ross fesselten.
Der Oberst verschmähte es, auf die Danksagungen zu hören, die der auf dem Boden unbeweglich liegende Bandit an ihn richtete, und wandte sich wieder zu dem Boten.
»Wo ist die, welche Euch schickt?«, fragte er ihn.
»Dort«, erwiderte Juan, mit dem Finger auf eine Sänfte zeigend, die, von fünf Reitern begleitet, näher kam.
Von seiner lebendigen Last befreit, die ihn erschreckte, weigerte sich der Roncador dieses Mal nicht, in die Richtung zu jagen, wo die Vorhänge der Sänfte Gertrudis in den letzten Strahlen des untergehenden Mondes wallten.


