Der Schwur – Dritter Teil – Kapitel 8
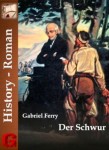 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Dritter Teil
Der See Ostuta
Kapitel 8
Der verzauberte Hügel
Die Gestirne zeigen ungefähr zehn Uhr an. Der klare Himmel überwölbt einen bedeutenden Teil einer Ebene, die bald bewaldet, bald ganz kahl und sumpfig, oder auch mit dürftigen, den Dünen ähnlichen Hügeln durchzogen ist. Ein See, oder vielmehr ein ungeheurer Teich, nimmt vom Ganzen den Mittelpunkt ein. Dies ist der See Ostuta.
Der See bietet den trüben und trostlosen Anblick dar, den nach den Aussagen der Reisenden das tote Meer gewähren soll, seitdem der Zorn Gottes verfluchte.
Seine trüben und dunklen Wasser spiegeln keinen Stern zurück, sie peitschen, von einem Windstoß, der klagenden Stimmen gleicht, in Bewegung gesetzt, traurig ein sumpfiges Ufer, das mit Schilf, mit dürren Stendeln und verwelkten Rohrkolben bedeckt ist.
Im Norden bildet eine Hügelkette, die sich in das Unabsehbare verliert, die Grenze des Sees, im Süden dagegen ein dichter Wald. Im Osten dehnt sich die Ebene aus, in der die Gewässer rinnen, die dem See das Wasser zuführen, während im Westen ein dichter Vorhang von Zedern mit dunklem Blätterdach seine Gipfel in dichtem Nebel verbirgt.
In der Mitte des Sees erhebt sich ein Hügel, dessen schwarz-grüne Masse mehr einer ungeheuren Klippe als einer Insel gleicht. Dicke Dämpfe, die aus dem Wasser aufsteigen und welche die Nachtkälte noch mehr verdichtet, bilden einen Wolkenschleier um seinen Gipfel. Nach den zahllosen Spalten, die seine Seiten durchziehen, zu urteilen, könnte man versucht sein, zu glauben, dass das Ganze nur verworrener Haufen von Schutt und Lavatrümmern sei, den vor grauen Jahren ein Vulkan ausgespien habe. Bei Nacht verleiht der schräg auf die übereinander gelagerten Schichten, woraus der Hügel besteht, fallende Mondstrahl ihnen eine entfernte Ähnlichkeit mit den Schuppen, die den scheußlichen Panzer des Alligators bedecken. Zugleich hört man auch das ungeheure Reptil sich in dem sumpfigen Schlamm an dem verlassenen Ufer des Sees herumwälzen und das Rohr unter dem zermalmenden Gewicht seines Körpers brechen.
Der traurige Anblick des Sees, die trübe, dunkle Färbung der Landschaft, welche ihn von allen Seiten umgibt, dieses ewige Stillschweigen, das rings umher herrscht, alles stößt an diesem Ort ein peinliches Gefühl an und rechtfertigt vollkommen die Wahl, welche die alten indianischen Opferpriester trafen, hierher die Wohnungen ihrer blutdürstigen Götter zu verlegen. Und so gewaltig ist die Macht der Tradition, dass auch noch in unseren Tagen der See Ostuta und der Monapostiac, der verzauberte Hügel, ihren alten Ruf bewahren und für die unwissende Bevölkerung der Umgegend ein Ort schrankenloser und abergläubischer Furcht sind.
Sicher, in dieser Einsamkeit einen guten Zufluchtsort zum Schutz gegen jede Gefahr zu finden, hatte der Diener Don Marianos, der als Führer diente, hier während der Nacht haltmachen lassen. Die Reisenden schlugen am Saum des Waldes, der den See im Süden begrenzt, ihre Lagerstätte auf.
Um aus dem Geist seiner Tochter die trüben Gedanken, die ihn beugten, zu verscheuchen, hatte Don Mariano befohlen, ihre Sänfte am freundlichsten Teil des Waldes niederzusetzen. Er wählte selbst den Ort aus, und zwar mit einer Sorgfalt, die gewiss von keiner anderen, selbst von der Don Rafaels nicht hätte übertroffen werden können.
In der Mitte einer Gruppe dicker Bäume aller Gattungen war eine schmale Lichtung, ein herrliches, von der Hand der Natur geschaffenes Baudoir, wozu das weiche und duftende Moos die Teppiche bildete. Tausende und Abertausende von Lianen, die sich bis zu den Gipfeln der höchsten Palmen hinaufschlängelten und deren Blätter und Blumen sich in graziösen Windungen um sich selbst ringelten, bildeten die Behänge. Eine herrliche, prachtvolle Decke spannte sich über den Bäumen aus, ein Stückchen des mit unzähligen Sternen übersäten Himmelzeltes, das sich durch den freien Raum der kleinen Lichtung zeigte.
Dort hatte man die Sänfte niedergesetzt, und in dem Moment, wo wir Gertrudis wiedertreffen, schlief sie einen kurzen und leisen Schlaf unter der Decke ihrer Sänfte, deren halb geöffnete Vorhänge ihr bleiches und schönes Antlitz auf den Spitzen ihres Kopfkissens sehen ließen.
Die Natur hatte fast schon die freiwillig an ihrem Haar ausgeübte Schmach wieder ausgeglichen, das Leben schien in ihrem Busen erschöpft zu sein. Gertrudis war in ihrem Schlummer das Bild der weißen Passionsblumen, die um sie herum sich entfalteten. Aber sie war nur das Bild der vom Stängel gerissenen Blume, auf dem, sie kurze Zeit vorher Leben und Kraft geschöpft hatte.
Don Mariano warf auf sie einen Blick voller Zärtlichkeit und machte vergebliche Anstrengungen, um den Gedanken an die genannte Ähnlichkeit von sich abzuwehren, der sein Herz zerriss. Er konnte sich nicht verhehlen, dass die zarte Blume, sobald sie gepflückt ist, unwiderruflich dem Tod geweiht ist.
In einiger Entfernung von Don Mariano und seiner Tochter, dem See etwas näher, saßen drei seiner Diener und hielten Wache, indem sie versuchten, sich mit Plaudern die Länge einer schlaflosen Nacht zu verkürzen. Der vierte Diener hatte sich entfernt, um die Furt zu suchen, die er aufzufinden sich anheischig gemacht hatte. Seine Kameraden erwarteten seine Rückkehr.
Durch die letzten, am Saum des Gehölzes stehenden Bäume erblickte man das schwarze und traurige Schattenbild des verzauberden Hügels.
In welchem Land man sich auch befinden mag, verfehlt alles, was gewissermaßen über die gewöhnlichen Gesetze der Natur gestellt erscheint, nicht einen gewaltigen Eindruck auf die Einbildungskraft wenig oder gar nicht gebildete Leute zu machen. Die Diener Don Marianos waren weit davon entfernt, eine Ausnahme von dieser Regel zu bilden.
»Ich habe erzählen hören«, sagte der eine von ihnen, »dass die trüben und schlammigen Gewässer dieses Sees ehemals, vor langer, langer Zeit, von sonderbarer, unübertrefflicher Klarheit gewesen sind und dass sie erst seit der Zeit, wo er dem Teufel geweiht wurde, ihre Beschaffenheit geändert haben.«
»Dem Teufel!«, unterbrach ihn ein anderer. »Warum hat denn Castrillo diesen verfluchten Ort zu einem Ruheplatz ausgesucht?«
»Weil die Banditen Arroyos nicht wagen werden, sich hierher zu verlaufen. Das ist ohne Zweifel der Grund«, entgegnete ein Dritter.
»Gerade deshalb«, begann der Erste wieder, der mehr als seine Kameraden zu wissen schien. »Man sagt, dass sich auf diesem grünen Berg schreckliche Dinge zugetragen haben sollen, und dass nur deshalb, um die Dinge, die noch vorfallen werden, den Augen der Menschen zu verhüllen, der Gott der alten Indianer, welcher niemand anders als der Satan selbst ist, diesen Nebelschleier um seinen Gipfel ausgebreitet hat.«
»Wenn man hier nun auch keine Gefahr von Menschen zu befürchten hat, existieren darum nicht andere, vor denen ein Christ schaudern muss? Was hat sich denn auf dem Gipfel dieses Hügels zugetragen, dessen Form und Farbe himmelweit von denen verschieden ist, die ich bisher gesehen habe.«
»Erstlich«, erwiderte derjenige, der das Gespräch begonnen hatte, »opferten dort die indianischen Priester an gewissen Tagen des Jahres eine so große Menge von Menschen, denen sie das Herz ausrissen, dass das Blut häufig in den Spalten des Felsens hineinfloss wie Regenwasser bei einem Platzregen. Dann noch erzählt man sich, dass einer dieser Unglücklichen, dem man das Herz ausgerissen hatte – aber was soll ich euch erst erschrecken, und mich mit … Meiner Treue, die Geschichte ist zu grausig.«
»Erzähle nur!«, riefen seine Kameraden, unwillkürlich schaudernd, denn in demselben Augenblick erklang ein fremdartiger Ton vom Schilf her. »Habt Ihr das Geräusch gehört?«
»Ja, es ist ein Kaiman, der mit seinen Kinnbacken gegeneinander klappte. Nun, da Ihr es wünscht«, fuhr der Erzähler fort, »so hört. Es scheint, dass man eines Tages eben damit beschäftigt war, einem dieser Unglücklichen die Brust zu öffnen. In dem Moment, wo der Opferpriester ihm das Herz ausriss, sprang das Schlachtopfer auf, riss es aus den Händen des bestürzten Priesters und versuchte, es wieder in die Brust zu stecken, aber seine Hand zitterte, sein Herz entglitt ihm und rollte in den See. Das Opfer stieß einen furchtbaren Schrei aus und stürzte sich in das Wasser, um es zu erhaschen. Ein solcher Mann durfte nicht sterben, wie ihr es euch wohl denken könnt, und nun irrt dieser Indianer seit – ungefähr fünfhundert Jahren an diesen trostlosen Ufern mit weit klaffender Brust umher und sucht vergeblich sein Herz, das er an seine alte Stelle anlegen will. Wie man mir gesagt, ist es kaum ein Jahr her, dass man ihn im See hat untertauchen sehen.«
Der Diener schwieg, und seine schaudernden Zuhörer warfen einen unwillkürlichen und nicht allzu beherzten Blick zu dem Hügel, den ehemals nur zu oft Menschenblut gefärbt hatte und über dem sich eine Nebelkappe ausdehnte.
»Vielleicht verbirgt sich der Indianer, der sein Herz sucht, unter dem Nebelschleier«, begann er wieder, »denn man hat mir nicht erzählt, was dort vorgeht. Indessen ist es wahrscheinlicher, dass er, anstatt sich da oben die ganze Nacht hindurch hinzukauern, seine Nachforschungen fortsetzt.«
»Wenn wir ihn nur nicht sehen!«, sagte einer der Zuhörer. »Der Teufel möge Castrillo in den Hals fahren, dass er uns hierher geführt hat.«
»Sprich nicht vom Teufel in seinem eigenen Haus«, warf der zweite Zuhörer mit leiser Stimme ein.
Ein plötzliches Krachen in den Gebüschen entriss den drei Dienern gleichzeitig eine Gebärde des Schreckens, der nur von kurzer Dauer war. Castrillo kehrte von seinem Ausflug zurück.
Castrillo selbst schien eben nichts sehr erbaut.
»Nun, was hast du gesehen?«, fragten ihn seine Kameraden.
»Ich bin fast bis nach San Carlos gewesen«, sagte er. »Die Zugänge dorthin scheinen frei zu sein, es brennt kein einziges Feuer mehr an den Ufern des Flusses. Ich würde mich sogar in das Haus gewagt haben, aber ich habe einen so sonderbaren Feuerschein hinter den Fenstern leuchten sehen, dass mir, meiner Treue, das Herz dazu gefehlt hat.«
»Was war es denn?«
»Rote, violette und blaue Lichter, wie die Flammen sein sollen, die nie verlöschen«, erwiderte Castrillo in feierlichem Ton. »Und dennoch konnte ich es nicht recht glauben, denn Don Fernando Lacarra ist am Ende doch ein guter Christ. Wie ich noch mit mir zurate ging, sah ich ein weißes Gespenst unter den Bäumen forthuschen und bin dann in vollem Lauf hierher geeilt, es dem morgigen Tag überlassend, mir diese Geheimnisse der Finsternis zu erklären.«
Der Bericht des Kundschafters trug durchaus nicht dazu bei, die abergläubische Furcht derer zu zerstreuen, zu denen er gekommen war.
»Habt ihr hier nichts gesehen, was imstande gewesen wäre, euch zu beunruhigen?«
»Nein, alles ist verlassen und einsam«, erwiderte Castrillo, »und mit Ausnahme des Indianers, der sein …«
»Sein Herz sucht!«, rief einer der Diener.
»Sein Herz? Du bist ein Narr! Nein, seinen Esel. Mit Ausnahme dieses Menschen habe ich nichts gesehen«, fügte Castrillo hinzu.
»Zum Teufel! Du hättest uns bald Furcht gemacht mit deinem Indianer, seit Zefirino uns die Geschichte von dem erzählt hat, der seit fünfhundert Jahren in diesen See taucht«, sagte einer der Zuhörer der so schrecklichen Erzählung von dem Mann ohne Herz.
»Das schließt gar nicht aus, dass wir ihn auch nicht sehen werden«, erwiderte der andere, »und ich gestehe, dass diese Flammen und dies Gespenst mir nichts Gutes zu weissagen scheinen.«
Castrillo ließ nun seine Kameraden nach Belieben ihre Vermutungen über die seltsame Erzählung, die er ihnen soeben mitgeteilt hatte, machen, und ging zu seinem Herrn, um dem zu berichten, was er gesehen hatte.
Als Don Mariano den Kundschafter sich nähern hörte, ließ er die Vorhänge der Sänfte Doña Gertrudis’ zurückfallen, um sie jedem unberufenen Blick zu entziehen.
»Sprich leise, meine Tochter schläft.«
Der Diener begann seinen Bericht mit leiser Stimme und wollte ihn soeben beenden, als Don Mariano ihn unterbrach.
»Die Furcht hat deine Vernunft verwirrt«, sagte er, »und die Flammen haben aller Wahrscheinlichkeit nach nur in deinen Augen existiert.«
»O, hoher Herr, sie waren nur zu wahr, und wenn Ihr sie wie ich hättet größer werden, sich zusammenziehen und jeden Augenblick die Farbe verändern sehen, würdet Ihr weder an Euren Augen noch an Eurer Vernunft gezweifelt habe. Gebe übrigens Gott, dass ich mich getäuscht habe.«
In dem Ton des treuen Dieners lag so viel Überzeugung, dass Don Mariano Silva sich einer gewissen Unruhe nicht erwehren konnte, die zwar nicht von einem abergläubischen Schrecken, sondern mehr von jenem unerklärlichen Ahnungsvermögen, welches ein großes Unglück vorher verkündet, herrührte, und die seine Vernunft vergebens bekämpfte, die der Bericht Castrillos wieder in ihm rege machte.
»Und du sagst, dass die Zugänge zur Furt jetzt unbesetzt sind?«, fragte er von Neuem.
»Die Zugänge zum Fluss sind unbesetzt, und dennoch wage ich nicht, Euer Herrlichkeit zu raten, vor Anbruch des Tages sich auf den Weg zu machen.«
»Ich werde darüber nachdenken«, entgegnete Don Mariano, seinen Diener verabschiedend.
Er blieb nun allein bei seiner Tochter, die fest eingeschlafen war, sich seinen trüben Gedanken überlassen. Mit Mühe nur gelang es ihm, den Gedanken von sich zu weisen, dass eine große Gefahr, fern von ihm, ihrer Schwester Marianita drohe.
Plötzlich wurden die Vorhänge der Sänfte geöffnet und dadurch die düsteren Gedanken Marianos einen Augenblick unterbrochen.
»Der Schlaf hat mich erquickt«, sagte seine Tochter, sich mit dem Ellenbogen auf ihr Kissen stützend. »Können wir uns nicht wieder auf den Weg machen? Ohne Zweifel wird der Tag bald anbrechen.«
»Es ist erst Mitternacht«, antwortete Don Mariano, »und daher noch lange bis zum Tagesanbruch.«
»Warum schläft du nicht, mein Vater? Wir sind, wie es scheint, hier in Sicherheit.«
»Dem stimme ich bei, ich habe keinen Schlaf, und ich will nur erst unter dem Dach schlafen, unter dem ihr beide vereinigt sein werdet, Du und Marianita.«
»Sie ist sehr glücklich, Marianita. Das Leben ist für sie bis jetzt nichts als einer dieser blumigen Pfade gewesen, die wir in diesem Wald gesehen haben«, fügte Gertrudis bei dem Gedanken an das Glück ihrer Schwester lächelnd hinzu.
Don Mariano seufzte und antwortete: »Das Glück wird auch bei dir einkehren, Gertrudis. Es wird nicht allzu lange währen, und du wirst Don Rafael in geflügelter Eile herbeikommen sehen.«
»Ja, weil er bei seiner Ehre geschworen hat, bei dem verabredeten Zeichen zurückzukehren, das ist dann auch alles«, versetzte Gertrudis mit schmerzlichem Lächeln.
»Er hat nie aufgehört, dich zu lieben, mein Kind!«, sagte Don Mariano, eine Überzeugung aussprechend, die er nicht besaß. »Es herrscht zwischen euch nur ein Missverständnis.«
»Ein Missverständnis, an dem man stirbt, mein Vater!«
Gertrudis versuchte ihre Tränen zu verbergen, indem sie ihren schwindelnden Kopf auf das Kissen zurückfallen ließ.
Es entstand eine plötzliche Pause.
Jetzt schien Gertrudis wieder, durch eine momentane Rückwirkung einer kranken Seele, einige Hoffnung zu fassen.
»Meinst du, dass der Bote schon Zeit gehabt hat, Don Rafael aufzufinden?«, fragte sie.
»Er braucht drei Tage, um von Oajaca zur Hazienda del Valle zu kommen. Seit seiner Abreise sind schon vier Tage verflossen. Wenn, wie man uns gesagt hat, Don Rafael sich vor Huajapam befand, so würde ihn unser Bote ohne Zweifel morgen dort erreichen. In drei, höchstens vier Tagen kann der Oberst in San Carlos sein, wohin, wie Don Rafael weiß, wir uns begeben.«
»Vier Tage, das ist sehr lange!«
Gertrudis wagte nicht zu sagen, dass, ihre Kräfte kaum diesen Zeitraum überdauern würden. Sie begann nach einem Schweigen von einigen Augenblicken wieder.
»Nun aber, wenn ich mit niedergeschlagenen Augen und vor Scham geröteter Stirn die Stimme Don Rafaels hören werde, die zu mir sagt: ›Sie haben mich rufen lassen, Gertrudis, hier bin ich.‹ Was soll ich ihm dann antworten? Ich werde vor Scham und Schmerz sterben. Denn er liebt mich nicht mehr. Und wenn er mich so entstellt sieht, wenn er von der, die er blühend in Wohlsein und Jugendfrische verließ, kaum noch den Schatten wiederfindet, so wird er vielleicht aus Großmut eine Liebe zu heucheln suchen, die er nicht mehr empfindet, und an die ich nicht glauben kann. Welchen Beweis wird er mir geben können, damit ich erkenne, dass er nicht nur Mitleid für mich lügt?«
»Wer weiß«, erwiderte Don Mariano, »vielleicht gibt er dir einen Beweis von Aufrichtigkeit, den du nicht in Zweifel ziehen kannst.«
»Wünsche es nicht, wenn du mich liebst!«, rief Gertrudis, »denn, wenn der Beweis ein solcher wäre, den man nicht missdeuten könnte, würde ich vor Glückseligkeit sterben. Armer Vater!« fügte sie mit Schluchzen hinzu, indem sie ihre Arme um den Hals desselben schlang, »armer, Vater! Der auf jede Weise bald nur noch ein Kind haben wird.«
Bei diesem schmerzlichen Ausruf fühlte Don Mariano sein Herz brechen, und er vermochte nur ein dumpfes Stöhnen und reichliche Tränen mit denen seiner Tochter zu vermischen. Nicht weit von ihnen wiederholte ein Spottvogel ihr Schluchzen mit melancholischer Stimme.
In diesem Augenblick trat der Mond voll und strahlend hinter einem Wolkenschleier, der ihn bisher bedeckt hatte, hervor und alles schien unter seinen blassen Strahlen, die er über die Einsamkeit ausgoss, sich wieder zu beleben. Der Wald wurde weniger düster, den steilen Seitenwänden des Monapostiac entströmte ein durchsichtiger, grünlicher Schimmer, wie den Wogen eines stürmischen Meeres. Die Oberfläche des Sees färbte sich mit bleichen Farben, schwarze und gräuliche Gebilde, ähnlich denen des Alligators, dehnten sich im Schilf aus, dann ließ sich ein dumpfer, ferner Lärm in den angrenzenden Dickichten vernehmen.
Ein Schauer des Schreckens durch rieselte den Körper der vier Diener, die unbeweglich, mit starr zum See gerichteten Augen, da saßen.
»Habt ihr nichts gehört?«, flüsterte Zefirino.
Alle horchten und erbleichtetn. Man hätte sagen können, dass eine menschliche, wenn auch undeutliche Stimme sich von der Tiefe des Schilfes her in wunderlichen, langgezogenen Tönen vernehmen ließ.
Die Stimme verstummte plötzlich, sodass jeder glaubte, sich getäuscht und das entfernte Rauschen im Wald für eine menschliche Stimme gehalten zu haben.
»Es ist einerlei«, sagte einer der Diener, »ich wünschte wohl, dass diese Nacht erst vorüber wäre. Es sind wenigstens noch fünf Stunden bis zum Morgen.«
»Um so mehr«, begann der Zweite, »da zuviele Zeichen angedeutet haben, dass sie nicht ohne irgendein Unglück vorübergehen wird. Ich rede nicht von den Flammen und den Gespenstern, die Castrillo gesehen hat, ich denke nur an die Seufzer, die wir unsere unglückliche junge Herrin eben haben ausstoßen hören.«
»Zu allen diesen Anzeichen fehlt weiter nichts mehr, als dass wir noch den Schrei einer Eule auf dem Gipfel irgendeines Baumes zu unserer Linken hören, dann könnten wir für die Seele der armen Doña Gertrudis beten.«
Castrillo und Zefirino, die, ohne gerade mehr Freigeist zu sein als ihre Kameraden, doch der Furcht der Vorzeichen weniger zugänglich schienen als diese, teilten nichtsdestoweniger auch ihre Befürchtungen in Betreff ihrer jungen Herrin. Ihre Schwäche schien seit dem Tag der Abreise von Oajaca immer zugenommen zu haben. Beide schwiegen, indem auch sie dachten, dass dies tatsächlich keine gewöhnliche Nacht sei, die sie in der Nähe eines verrufenen Ortes zubrachten. Castrillo selbst wunderte sich, diesen Ort ausgesucht zu haben, wozu noch die sonderbare Erscheinung der Flammen trat, die er in der Hazienda San Carlos gesehen hatte.
»Doña Gertrudis ruht jetzt«, sagte Zefirino, »denn ich höre nichts. Wir würden gar nicht übel tun, auch ein paar Stunden zu schlafen, und zwar zu zweien, der Reihe nach.«
»Auf die Weise können wir wenigstens jeder drei Stunden schlafen«, fügte Castrillo hinzu. »Ich bin auch der Meinung. Wer sind die, welche zuerst wachen?«
»Das Los soll darüber entscheiden«, sagte Zefirino.
»Wenn Ambrosio nicht mehr Lust zum Schlafen hat wie ich«, fiel der dritte Diener ein, »wollen wir beide den Anfang machen. Wir werden während eures Schlafes Wache halten.«
»Ich wache mit«, sagte Ambrosio.
Castrillo und Zefirino streckten sich, nachdem sie sich in ihre Mäntel gehüllt hatten, in das Gras, und bald wachte, scheinbar wenigstens, niemand weiter im Wald als die beiden Wachen und Don Mariano, von dessen Augen die Unruhe den Schlummer verscheuchte.
Was Gertrudis anbetrifft, so hatte, ganz abgesehen davon, dass sie noch in einem Alter stand, welches wie die Kindheit das Vorrecht hat, uns mit Tränen in den Augen einschlummern zu lassen, der Zustand ihrer Schwäche den Kummer ihres Herzens beschwichtigt.
Das Schweigen der Nacht wurde durch nichts unterbrochen, und die beiden Wachen befragten sich, die Augen starr auf den Gipfel des verzauberten Hügels gerichtete, was für Geheimnisse diese Nebelschicht verbergen konnte, die nach der Aussage Zefirinos ihn ohne Unterlass bedeckte, als plötzlich in der Richtung zum See zu dieselben wilden Rhythmen, die sie schon einmal gehört zu haben glaubten, sich wieder vernehmen ließen.
Nur war es unmöglich zu verstehen, was die Stimme sang. Es war eine vollkommen unbekannte Sprache, wie die, in welcher dreihundert Jahre früher die indianischen Priester zu ihren Gottheiten gesprochen haben sollen.
Beide bekreuzigten sich und tauschten einen erschrockenen Blick aus.
»Das ist vielleicht der Indianer, der sein Herz sucht«, sagte Ambrosio mit kaum verständlicher Stimme.
Sein Kamerad konnte nur ein stummes Zeichen mit dem Kopf machen, um anzudeuten, dass er derselben Meinung sei. Dann schüttelte er einige Minuten später einen der Schläfer.
»Was gibt es?«, fragte Zefirino plötzlich erwachend.
Der Diener erwiderte nichts, zeigte aber zitternd mit dem Finger auf einen Gegenstand, der im Schilf des Sees umherstreifte.
Es war ein Mann, dessen Haut, die so rot wie Kupfer glänzte, den der Mond beschien, denn er war vollständig nackt.
Der Indianer, den man seiner Hautfarbe nach für nichts weiter halten konnte, schien etwas im Schilf, das er mit den Händen um sich zerteilte, zu suchen.
Bald darauf sahen ihn die beiden Diener im See schwimmen, die trüben Wasser des Sees zerteilend, und gleich darauf in dem Schatten verschwinden, welchen der verzauberte Hügel auf die dem Mond abgewendete Seite warf.
»Gott im Himmel!«, sagte Zefirino mit leiser Stimme, »man kann nicht mehr daran zweifeln, es ist der Indianer, der sein Herz sucht.«


