Jimmy Spider – Folge 24
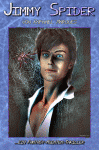 Jimmy Spider und der Kampf um die Mona Lisa
Jimmy Spider und der Kampf um die Mona Lisa
Es war keine Nacht, es war kein Nebel, und dennoch konnten wir häufig nicht die Hand vor Augen sehen. Das lag weniger an unserem mal mehr, mal geringer vorhandenen Alkoholpegel (auf dem Flug in die USA hatte ich mir zwei Gläser meines höchst verlustgefährdeten Wodkas zu Gemüte geführt), sondern eher an den Niagarafall-artigen Schweißausbrüchen, die von unseren Stirnen – und nicht nur von dort – hernieder rannen.
Die Luft stand förmlich vor Hitze. Selbst die Schatten der Bäume konnten uns nicht vor der gnadenlosen Wärme der Sonne und den brütenden Ausdünstungen der Sümpfe schützen.
Dazu kam, dass wir nicht gerade dem Wetter angepasste Kleidung trugen. Ich hatte zwar darauf verzichtet (nicht jedoch auf meinen Anzug und die Seidenhose, allerdings wie meine Schuhe komplett in weiß), aber die meisten trugen Uniformen und Schutzkleidung, insbesondere kugelsichere Westen.
Neben mir befanden sich noch Tanja Berner, Jack Kasahara (der bereits bei der Schießerei in dem Pariser Museum, in dem der französische Geheimdienst völlig sinnfrei die Mona Lisa versteckt gehalten hatte, dabei gewesen, mir aber dabei nicht aufgefallen war) sowie Commander Rathbone und seine sechs Mann starke Truppe – von denen allerdings keiner bei dem Kampf gegen die Monchoppies beim Fall des gestohlenen Tigerordens mit dabei gewesen war. Wie ich mir hatte sagen lassen, waren die Überlebenden damals nicht allzu begeistert über den Kampf gegen kuschelige, menschenfressende Monster gewesen, sodass sie sich allesamt ruhigere Jobs gesucht hatten. Einen hatte es sogar als Tankstellenwärter in die Wüste von Arizona gezogen. Eine boomende Branche …
Jedenfalls befanden wir uns in einem Wald, der sich auf einer Halbinsel an einem Nebenfluss des Mississippi befand. Die Gegend wurde von den Einheimischen gemieden, angeblich sollten hier des Nachts unheimliche Dinge vorgehen. Allerdings hatte man uns auch davor gewarnt, dass in dem Wald ein angeblicher Serienmörder namens Wild Bill hausen könnte, ein Afroamerikaner, der mehrere Voodoo-Priester ins Jenseits befördert hatte. Das Positive daran war, dass wir uns vor möglichen Begegnungen mit verwilderten Zombies wohl nicht zu fürchten brauchten.
Unser Freund und Kollege Dave Logger hatte es vorgezogen, in einem Krankenbett eine kurze Dienstpause einzulegen, nachdem er in Paris von den sombras angeschossen worden war. Mittlerweile war er bereits nach Manchester ausgeflogen worden.
Über die Schatten-Killer hatten wir leider nichts weiter in Erfahrung bringen können. Es war durchaus möglich, dass sich auch hier in der Gegend noch einige von ihnen aufhalten konnten. Gesetz dem Fall wir waren hier überhaupt an der richtigen Adresse. Denn außer einem Haufen Dreck, der wohl von den Dieben der Mona Lisa stammte, hatten wir nichts, das auf ihren Aufenthaltsort hinwies.
Jeder von uns hielt seine Waffen in den Händen, bereit, jederzeit zu schießen. Rathbone und seine Männer trugen ihre MP5, während Kasahara, Tanja und ich unsere normalen Dienstwaffen benutzten. Wir waren schließlich nicht hier, um auf Großwildjagd zu gehen, sondern um das wertvollste Gemälde der Welt (möglichst ohne Kugellöcher) nach Frankreich zurückzubringen.
Hinter einem Baumstamm verharrte ich kurz und atmete tief durch. Irgendein Busch hatte meine kurze Pause mit seinem Leben bezahlen müssen, denn ich stand direkt auf ihm.
Neben mir hielt Tanja Berner inne. »Pass übrigens auf, dass du nicht auf das Edelgoldfarn trittst. Es muss hier irgendwo in der Gegend wachsen.«
Ich schaute an mir herab, hob meinen linken Fuß und kratzte mir die Reste des Busches von der Schuhsohle. Für einen Moment stockte ich. Dann wurde mir einiges klar.
»Ähm, Tanja?«, fragte ich vorsichtig.
»Ja?«
»Ich glaube, ich hab einen der Farne gefunden.« Dabei wies ich auf die grüne Pampe, die an meinem Schuh klebte.
»Jimmy!«, rief sie, halb wütend und halb belustigt.
»Ja, ja«, antwortete ich, während ich ein Taschentuch hervorholte und mir die klebrigen Reste der Pflanze von der Sohle wischte. »Gab es nicht noch mehr von den Dingern?«
Die Schweizerin lächelte mich leicht verschmitzt an. Wer hätte diese Reaktion noch für möglich gehalten? »Professor LaCroix sagte, es gäbe noch zwei. Einen muss einen der Einbrecher zertreten haben, der andere … naja, hoffen wir, dass sie sich mittlerweile vermehrt haben.«
Das hoffte ich auch, obwohl ich mich fragte, wen es wohl stören würde, dass ich für die Ausrottung eines Farnes verantwortlich sein könnte, von dem zum einen fast niemand wusste und von dessen Existenz ich erst vorgestern erfahren hatte. Die Weltwirtschaft würde davon sicher nicht zusammenbrechen – hoffte ich zumindest.
Von der rechten Seite tauchte Commander Rathbone auf. Wegen der Hitze hatte er auf einen Helm verzichtet, deshalb fiel mein Blick auf sein schon leicht ergrautes, schwarzes Haar. Er hatte ein kantiges, etwas verlebt wirkendes Gesicht mit einer hübschen Narbe an der linken Backe. »Geht es jetzt weiter, Sir?«, fragte er, ohne meine Partnerin überhaupt zu beachten.
»Ja, natürlich. Wir haben nur gerade festgestellt, dass wir am richtigen Ort sind.« Ich wies auf die grünen Reste vor meinen Füßen.
Der Commander blickte nach unten und verstand nichts. Dann zuckte er mit den Schultern und ging zu seinen Männern zurück. Jack Kasahara, ein recht schweigsamer Typ, stand etwas abseits und behielt mit seinem Fernglas die Gegend im Auge. Irgendetwas schien seine Aufmerksamkeit erregt zu haben, denn er winkte uns zu sich. Als wir neben ihm standen, reichte er mir sein Fernglas. »Schauen Sie!« Er wies auf eine Stelle mitten zwischen den alten und teils morschen Bäumen. »Da scheint ein Haus zu stehen.«
Ich tat ihm den Gefallen und brachte das Fernglas in Position. Zunächst sah ich nur Sumpf … ein paar Bäume … Insekten auf Menschenjagd … Nacktmodels beim Tanz um den Maibaum … Moment mal. Ich rieb mir über die Augen. Vielleicht hätte ich doch auf den Wodka verzichten sollen.
Beim zweiten Versuch klappte es besser. Tatsächlich, zwischen alten und schief gewachsenen Eichen lugte die Ecke eines weiß angestrichenen Hauses hervor.
Hatte Professor LaCroix vor seinem spektakulären Ableben nicht erwähnt, dass dies hier eine menschenleere Gegend ohne jedes Gebäude wäre? Entweder die CIA hatte ihm über dieses kleine Detail etwas vorgeflunkert, oder das Haus war erst errichtet worden, nachdem der Geheimdienst diesen Bereich verlassen hatte. Wie auch immer, dieses Haus war damit zu einem Fixpunkt bei unserer Suche geworden. Ich wies Rathbone und seine Männer darauf hin, und gemeinsam machten wir uns auf den Weg – hoffentlich zur Mona Lisa …
***
»Wir bekommen Besuch«, flüsterte der dunkelhäutige Mann mit den kurzen schwarzen Haaren.
»Ich weiß«, gab der Weiße neben ihm zurück.
»Wenn du das so genau weißt, wieso sind wir dann noch hier?«
»Weil ich diesen Besuch erwartet habe, Billy.«
»Hör auf, mich immer so zu nennen!«
»Ich nenne dich so, wie ich will.« Der Mann reichte seinem Gegenüber eine Pistole mit Schalldämpfer. »Damit wirst du unsere Gäste begrüßen.«
»Nein!«, antwortete er. »Du weißt doch, dass ich niemals Schusswaffen benutze.« Er zog eine Machete mit besonders langer Klinge. »Damit werde ich sie begrüßen«, sagte er mit einem feisten Grinsen im Gesicht.
»Ganz wie du meinst. Es ist ja dein Leben. Und jetzt auf unsere Posten, Bruderherz …«
***
Hatte ich schon das Versteck der Mona Lisa in Paris als haarsträubend angesehen, so setzte diese morsche Bruchbude dem Fall noch nie Krone auf. Wenn sich dort tatsächlich die ach so gerissenen Diebe der Mona Lisa (und wenn meine Vermutung mich nicht täuschte, auch die des goldenen Kätzchens der Inka, des Tigerordens und der Kronjuwelen) versteckt hielten, dann waren sie entweder von allen guten Geistern verlassen (wobei ich nicht ausschließen wollte, dass sich in diesem verfallenen Häuschen nicht doch die eine oder andere Spukgestalt herumtrieb), oder sie hatten einfach keinen Sinn für guten Geschmack.
Das Gebäude mochte vor gut fünfzig Jahren mal ein hübsches kleines Herrenhaus gewesen sein, in das sich gewisse Herrschaften in den Wintermonaten zurückzogen, aber mittlerweile waren die Balken, aus denen das Haus gezimmert worden war, morsch und aufgesprungen, teilweise sogar eingebrochen. Die Fenster sahen verschmutzter aus als die Bullaugen der Titanic und die Holztreppe, die zur Eingangstür hinaufführte, machte den Eindruck einer drapierten Todesfalle. Trotzdem entschieden wir uns dafür, das Haus zu betreten.
Commander Rathbone erschien neben mir. »Sir, ich würde vorschlagen, dass drei von meinen Männern mit ihnen da hineingehen, während ich mit dem Rest hier draußen Wache halte.«
Hatte der Commander etwa Angst vor Geisterhäusern? »Und warum kommen Sie nicht mit?«
»Wer weiß denn schon, ob sich in dem Haus wirklich jemand versteckt hält? Ich will meine Leute von hier draußen koordinieren können. Sie können da drinnen meine Aufgabe durchaus auch alleine erledigen.«
Danke für die Blumen, lag mir auf den Lippen. Stattdessen nickte ich nur und gab ein kurzes »Okay« von mir, obwohl ich seine Reaktion immer noch als etwas merkwürdig empfand.
Rathbone wies drei seiner Männer an, mir zu folgen und auf mein Kommando zu hören. Sie nickten und gesellten sich zu Tanja Berner, Jack Kasahara und mir.
Die Schweizerin stieß mich leicht an der rechten Seite an. »Irgendwie hab ich kein gutes Gefühl bei der Sache«, flüsterte sie.
»Ich auch nicht. Aber was sollen wir sonst machen? Freundlich anklopfen und warten, ob jemand öffnet?«
Tanja sah mich nur schief an und ging dabei langsam auf das Haus zu.
Ich übernahm die Führung, ging die (doch nicht ganz so einsturzgefährdete) Treppe hinauf und legte meine linke Hand auf die Türklinke, während ich meine Desert Eagle in der rechten bereithielt.
Ich drückte die Klinke nach unten und stieß die Tür auf.
Als ich eintrat, empfingen mich eine gefühlt meterdicke Staubschicht und zahlreiche Spinnenweben. Allerdings erkannte ich auch, dass wir nicht die ersten Besucher in letzter Zeit hier waren. Einige Fußspuren führten bereits durch das Haus.
Ich winkte meinen Begleitern zu und folgte der Spur.
Die Räume, durch die wir gingen, waren nur sehr sporadisch möbliert – einige Stühle, ein Tisch und in einer Ecke ein Kühlschrank, in den ich lieber keinen Blick riskierte. Die Spur führte schließlich zu einer geschlossenen Tür neben einer Treppe, die in den ersten Stock führte.
Da keine der Spuren nach oben führte, verzichtete ich darauf, mich im ersten Stock umzusehen.
Erneut legte ich meine linke Hand auf die Klinke und zog die Tür auf. Dass uns dahinter eine weitere, nach unten führende Treppe empfing, überraschte uns kaum, die Tatsache aber, dass hier bereits Licht brannte, umso mehr. Eine einsame nackte Glühbirne baumelte leuchtend an der Decke.
»Scheint, als würde man uns bereits erwarten«, murmelte ich, bevor ich mich auf den Weg nach unten machte.
Nach etwa dreißig Stufen machte die Treppe einen Knick in die entgegengesetzte Richtung. Dass dieses Haus einen derart großen Unterbau hatte, wunderte mich. Für ein Haus dieser Bauart war das alles andere als normal. Aber möglicherweise befanden wir uns auch nicht in einem normalen Haus.
Am Ende der Treppe empfing uns eine weitere Tür. Überraschenderweise legte ich wieder meine linke Hand auf die Klinke und drückte diesmal die Tür auf.
Uns empfing tatsächlich ein relativ großer, hell erleuchteter Raum – ein Laboratorium. Allerdings waren alle Gerätschaften schon etwas veraltet und ziemlich verstaubt. Drei Reihen länglicher Labortische füllten den Raum aus.
Tanja Berner trat neben mich. »Was denkst du, wo wir hier gelandet sind?«
»Ich vermute mal frei von der Leber weg, dass dies ein Labor der CIA ist, in dem sie ihren Wunder-Farn getestet haben. Oder ein betrunkener Innenarchitekt hat sich einen schlechten Scherz erlaubt.«
»Aber das hat uns noch immer keinen Schritt weiter zur Mona Lisa gebracht.«
»Möglicherweise doch.« Ich deutete auf eine weitere Tür am anderen Ende des Labors hin.
Vorsichtig schritten wir auf sie zu, unsere Waffen erhoben.
Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, beobachtet oder zumindest unter Kontrolle gehalten zu werden. Außerdem drang mir ein beißender Geruch in die Nase, den ich nicht so recht zuordnen konnte. Aber irgendwo hatte ich ihn schon mal gerochen. Doch wo?
Ich verdrängte den Gedanken und blickte mich kurz zu meinen fünf Begleitern um. Alle hielten ihre Waffen bereit, aber keiner wagte es, ein Wort zu sagen.
Schließlich hatten wir die Tür erreicht. Als ich sie öffnete, erschien vor uns – eine weitere Treppe nach unten. Na super. So langsam fragte ich mich, ob uns dieses Haus an der Nase herumführen wollte. Oder die CIA hatte kein Geld für einen vernünftigen Aufzug gehabt.
Mittlerweile konnten wir uns unmöglich noch unterhalb des Hauses befinden. Diese Räumlichkeiten schienen irgendwo im Sumpf zu enden. Möglicherweise würden wir bald ein paar konservierte Leichen von unten betrachten dürfen. Ich konnte mir Schöneres vorstellen.
Vorsichtig schritten wir die Treppe hinab. Wieder baumelte eine brennende Glühbirne über unseren Köpfen.
Nach etwa vierzig Stufen fand auch diese Treppe ihr Ende. Allerdings erwartete uns keine weitere Tür, sondern ein offener Durchgang. Dafür wurde der beißende Geruch langsam unerträglich.
»Riechst du das auch, Jimmy?«, flüsterte Tanja hinter mir.
»Ja – hast du eine Ahnung, was das sein könnte?«
»Ja. Aber ich traue mich kaum, es auszusprechen.«
»Doch nicht etwa verwesende Aliens?«
»Nein. Monchoppies!«
Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Jetzt kam mir der Geruch auch umso bekannter vor. Warum war ich nicht gleich darauf gekommen? Schließlich hatte ich noch öfter als Tanja diesen Geruch genießen dürfen.
»Alle die Waffen bereithalten!«, wies ich meine Begleiter an. »Wir könnten gleich eine unangenehme Überraschung erleben.«
Ich zog eine Taschenlampe hervor, denn der Durchgang führte ins Dunkel. Auch Tanja Berner und Jack Kasahara zogen ihre Lampen, während Rathbones Männer weiter ihre MPs festhielten.
Das Erste, was ich mit meiner Lampe aus der Dunkelheit riss, war ein einsam in der Mitte eines Raumes stehender Stuhl. Allerdings kein normaler, dieser war nämlich aus dicken Stahlteilen gebaut und besaß Feststellungsringe an den Armlehnen. Ob die CIA hier ihre Delinquenten mit dem Edelgoldfarn zum Reden hatte bringen wollen?
Nacheinander betraten wir den relativ großen Raum, ohne außer dem Stuhl irgendetwas Nennenswertes zu erblicken.
Plötzlich erklang aus einer im Dunkeln liegenden Ecke des Raumes ein lautes Klatschen. Irgendjemand schien uns zu applaudieren.
»Herzlichen Glückwunsch, Jimmy Spider. Sie haben es also tatsächlich bis hierher geschafft. Es freut mich wirklich, Sie mal wieder begrüßen zu dürfen.«
Ich leuchtete in die Richtung, aus der ich die Stimme zu hören glaubte – und zum Vorschein kam niemand anderes als Raymond Sterling!
Nun, meine Überraschung hielt sich in eng bemessenen Grenzen.
Aber Sterling war nicht allein. Neben ihm stand ein hünenhafter dunkelhäutiger Mann in Armeeuniform und hielt ein mit Papier verschnürtes Etwas in der rechten Hand (die linke war hinter seinem Körper verborgen. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass es sich dabei um die verpackte Mona Lisa handelte.
Ray schien meine Gedanken erraten zu haben. »Darf ich vorstellen: William Wild Bill Sterling. Mein Halbbruder. Und das, was er da in der Hand hält, ist tatsächlich die von Ihnen so wahnsinnig geliebte Mona Lisa. Natürlich gut verpackt.«
»Wie schön«, erwiderte ich. »Und was haben Sie jetzt vor? Es sieht ganz so aus, als hätten wir die besseren Argumente in der Hand. Also her mit dem Bild!«
»Das hätten Sie wohl gern. Aber wir haben bereits vorgesorgt. Keine Sorge, die sombras haben Sie bereits alle erledigt. Diese Typen scheinen wirklich nicht viel von ihrem Job verstanden zu haben. Aber da Sie sich ja jetzt doch alle hier eingefunden haben, kann die Show endlich losgehen.«
»Welche Show?«
Wortlos wies Ray zur Decke.
Ich ließ meinen Lampenstrahl nach oben gleiten – und zuckte zusammen.
Die gesamte Decke des Raumes war bedeckt mit Dutzenden von Monchoppies. Blaue, gelbe, rote, grüne, ja sogar pinke Kuschelmonster wieselten dort oben herum. Einige reckten mir ihre runden Köpfe entgegen und fauchten.
»Ach du Scheiße!«, entwich es mir.
Ein besonders großes Exemplar stach mir ins Auge. Es war völlig schwarz und hatte sechs statt fünf Glieder. Ob es dasselbe war, dass ich vor einigen Monaten beim Kampf um den Tigerorden in die Flucht geschlagen hatte, wusste ich nicht, aber da es mich mit einem typischen Wir zwei haben noch eine Rechnung offen-Blick anvisierte, konnte ich es mir durchaus vorstellen.
Raymond Sterling hatte sichtlich seinen Spaß. Während sein Halbbruder mit seiner linken Hand plötzlich eine Machete hervorzog, winkte Ray mir wie zum Abschied zu. »Machen Sie es gut, Spider. Ich werde Sie nicht vermissen.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit.«
»Wie schön. Und nun – fasst sie, meine Freunde!«
Auf sein Kommando hin stürzten sich die Monchoppies von der Decke auf uns.
Nun kam es darauf an, wer im Dunkeln die besseren Augen hatte. Da ich nicht unbedingt das schmackhafteste Ziel für diese Viecher abgeben wollte, legte ich lieber meine Lampe auf dem Boden ab. Tanja und Kasahara taten es mir nach.
Schon landete etwas Schweres und Fauchendes in meinem Nacken. Ich griff danach und warf es mir vor die Füße. In dem schwachen Licht konnte ich nicht feststellen, welche Farbe dieser Monchoppie hatte. Eigentlich war es mir auch egal.
»Guten Appetit!«, rief ich, bevor ich ihm zwei Kugeln in sein weit aufgerissenes Maul jagte.
Das Monster röchelte, wankte und fiel schließlich einfach um.
Neben mir hörte ich das Rattern der MPs und die Schreie meiner Begleiter. Ich versuchte, zu Tanja Berner zu gelangen (obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, wo sie war) und stolperte dabei über eines dieser Kuschelmonster. Sofort stürzten sich ein halbes Dutzend weiterer Exemplare auf mich.
Einem besonders aufdringlichen Exemplar schoss ich von unten in den Kopf. Irgendeine Masse spritzte auf der anderen Seite des Körpers empor und traf zwei weitere Monchoppies. Die fingen sofort an, erbärmlich zu schreien und waren nun erst mal anderweitig beschäftigt. Das Blut der Monster wirkte nämlich wie eine Säure.
Während ich versuchte, die Glieder des eben erschossenen Monchoppies von mir herunter zu bekommen, sah ich für einen Augenblick aus den Augenwinkeln Ray und seinen Halbbruder, wie sie sich ihren Weg zum Ausgang bahnten. Einer von Rathbones Männern, der keinen Blick für die beiden hatte, wurde von ‚Wild Bill‘ mit seiner Machete geköpft.
Nach diesem wenig erheiternden Anblick musste ich mich wieder um meine besonderen Freunde kümmern. Die hatten sich mittlerweile wieder formiert und wälzten sich förmlich auf mich zu.
Ich legte auf sie an und jagte einfach Kugel um Kugel ihnen entgegen.
Klick, Klick …
Mein Magazin war leer. Als ob ich so nicht schon genug Probleme gehabt hätte.
Ich trat zunächst den Rückzug an eine der Raumwände an, während ich in meinem Jackett nach einem Ersatzmagazin kramte.
Dabei stieß ich gegen irgendjemanden, der einen erstickten Schrei von sich gab.
»Bist du es, Tanja?«
»Jimmy! Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt.«
»Ein einfaches Ja hätte es auch getan.«
Sie ignorierte meine Bemerkung einfach. »Hast du etwas von den anderen gesehen?«
»Außer Schüssen … nein. Doch, Moment, einer von Rathbones Männern wurde ge… Deckung!«
Ich riss die Schweizerin mit mir zu Boden, während ein Monchoppie über uns hinweg segelte, dass uns hatte anspringen wollen.
Ein zweites versuchte es mit dem Konfrontationskurs und fing sich eine Kugel ein. Der Kopf des Monsters explodierte förmlich vor uns.
Ich nickte Tanja dankend zu, während ich endlich meine Desert Eagle nachlud.
Vor uns tauchte plötzlich einer von Rathbones Leuten auf. Sein Gesicht war blutüberströmt, die MP hatte er verloren. Er wollte uns wohl irgendetwas sagen, aber bevor er dazu kam, erschien neben ihm das schwarze Monchoppie. Es sprang ihn an, riss sein Maul auf und biss ihm einfach den Kopf ab.
Angewidert wandte ich mich ab, nur um eine Sekunde später doch wieder hinzuschauen, um dieses Monster endlich zu erledigen.
Über uns erklang ein Fauchen. Ich riss meinen Kopf herum und sah die Schemen mehrerer Monchoppies, die sich über die Wand angeschlichen hatten. Wieder stürzten sie sich auf uns.
Eines der Monster biss mir in die Schulter. Ich schrie schmerzerfüllt auf, schnappte mir dann aber den ballonartigen Kopf und riss ihn von meiner Schulter. Wütend drosch ich sein Maul gegen den Boden. Plötzlich hatte der Schädel die Form eines Halbmonds. Ich stieß den Kopf noch einmal gegen die harte Unterlage. Danach rührte sich das Wesen nicht mehr.
Zwei weitere Monchoppies versuchten sich als Möchtegern-Anakondas und umschlangen mich mit ihren Gliedern. Da ich von ihren nicht gerade widerstandsfähigen Körpern wusste, sprang ich von der Wand weg und warf mich einfach zu Boden.
Als ich ein merkwürdiges Platschen hörte und spürte, wie sich der Widerstand der Körper langsam auflöste, spürte ich auch ein merkwürdiges Kribbeln auf der Haut. Das Blut!
Ich sprang wieder auf, riss mir die Reste der Monster und meine Klamotten vom Oberkörper und warf sie von mir weg. Glücklicherweise hatte es das Blut noch nicht geschafft, sich vollständig durch mein Jackett zu fressen.
Nun ja, jetzt war meine Kleidung zumindest den Temperaturen angepasst. Nur hatte ich leider keine Sonnencreme dabei.
Auch Tanja Berner hatte inzwischen ihre Gegner in die ewigen Jagdgründe geschickt. Ich half ihr auf die Beine.
»Sieht aus, als hätten wir fast alle erwischt«, flüsterte sie.
»Ja … aber sie uns zum größten Teil auch, fürchte ich. Oder hast du in letzter Zeit einen Schuss außer unsere gehört?«
»Nein«, antwortete sie bedrückt.
Doch wir hatten uns zu früh gefreut. Etwas rammte uns aus der Dunkelheit und schleuderte uns zu Boden.
Etwas Großes glitt auf uns zu – das schwarze Monchoppie! Es wollte wohl nun endgültig die Rechnung zwischen uns begleichen.
Sah ich auf den Monsterlippen einen Ansatz von einem Lächeln? Ich würde es wohl nie erfahren, denn im nächsten Moment riss das Monster sein gewaltiges Maul auf und ließ mich auf zwei Reihen messerscharfer Zähne blicken.
Doch das Festmahl wurde ihm verwehrt. Plötzlich verschwand das Monster aus meinem Blickfeld und flog irgendwo in den Raum hinein.
Tanja Berner hatte sich wieder aufgerafft und das Monchoppie von mir herunter getreten.
Sie lächelte, während ich mich wieder aufrichtete. »Ich dachte mir, ich sollte dieses Vieh vor einer schlechten Mahlzeit bewahren. Du bist viel zu zäh.«
»Hast du mich etwa schon einmal ohne mein Wissen angeknabbert?«
»Das sollte ein Lob sein, Jimmy!«
»Na dann … ähm, danke.« Warum auch immer …
Unser heiterer Plausch wurde von dem Riesen-Monchoppie unterbrochen. Es griff wieder an, diesmal von vorne. Doch diesmal waren wir vorbereitet. Gleichzeitig hoben wir unsere Waffen und drückten ab.
Jede unserer Kugeln traf den übergroßen Körper, der förmlich durchgeschüttelt wurde und dabei wie eine Sambatänzerin auf dem Karneval in Rio wirkte. Wenn ich mir die Damen allerdings mit Fell vorstellte, brrr …
Schwer getroffen sank das Monster förmlich in sich zusammen.
»Das hätten wir also geschafft.« Und das stimmte auch, denn kein weiteres Monchoppie tauchte auf. Das gab uns die Zeit, einen Überblick über die Verluste zu gewinnen.
Von zwei Toten wusste ich bereits, einen dritten, oder vielmehr abgerissene Teile von ihm, fanden wir in der Nähe des Verhörstuhls. Nach der Kleidung zu urteilen gehörte er zu dem Spezialkommando.
Aber wo steckte Jack Kasahara?
Wie um mir diese gedankliche Frage zu beantworten, wankte plötzlich eine Gestalt auf uns zu. Tatsächlich, es war der TCA-Agent. Als er ins Licht einer der Taschenlampen trat, erkannte ich jedoch die Bescherung: Eines der Monster musste ihm seine linke Hand abgebissen haben. Es grenzte schon an ein Wunder, dass er sich überhaupt noch auf den Beinen halten konnte.
Tanja Berner ging einen Schritt vor und fing ihn ab, bevor er zu Boden stürzen konnte.
Ich hob eine der Taschenlampen auf und leuchtete auf seine Wunde. Der Anblick war wirklich alles andere als appetitanregend.
Ich legte die Lampe wieder ab, zog Kasahara sein Jackett aus und band es fest um die Wunde.
Ob er es bei diesem Blutverlust bis in ein Krankenhaus schaffen würde, war mehr als fraglich. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben.
Die Schweizerin wandte sich wieder mir zu. »Ich kümmere mich um ihn. Schnapp du dir Raymond Sterling.«
Ich zwinkerte ihr zu. »Nichts leichter als das.«
Hastig richtete ich mich auf, lud meine Desert Eagle erneut nach und lief auf den Gang zu.
Die Treppen schnell nach oben zu steigen war für mich kein Problem.
Im Labor empfing mich erneut nichts als Staub. Hier hielten sich Ray und Wild Bill also nicht versteckt. Ich hoffte, dass sie noch nicht über alle Berge waren. Aber mit einem sündhaft teuren Gemälde ging man auch nicht gern im Sumpf spazieren.
Schließlich hatte ich endlich wieder das Erdgeschoss des Hauses erreicht. Ich sah mich um. Niemand zu sehen.
Da fielen mir wieder Rathbone und seine Männer ein. Wenn Ray geflohen sein sollte, musste er an ihnen vorbeigekommen sein. Ich rannte zum Ausgang.
Im Rahmen der Tür blieb ich stehen. Commander Rathbone und seine Leute standen im hohen Gras, als hätten sie gerade eine Mittagspause gemacht. Keine Spur von Sterling und seinem Halbbruder.
Ich sprach die Männer darauf an. »Haben Sie zwei Flüchtende hier irgendwo vorbeikommen sehen?«
Ein Lächeln legte sich auf Rathbones Gesicht. »Ja.«
»Und?«
»Sie warten auf den Hubschrauber.«
»Und Sie sonnen sich hier genüsslich, oder wie?«
»Wir werden dafür gut bezahlt«, erwiderte der Commander, während er langsam seine MP hob. »Zumindest ich und meine drei Freunde hier. Die anderen haben von der ganzen Sache nichts gewusst. Schön, dass zumindest dieses Problem sich erledigt hat.
Ich hätte nicht gedacht, Sie noch einmal lebend wiederzusehen. Dabei war unsere Falle so ausgeklügelt. Dachten Sie wirklich, dass, nachdem wir erfahren hatten, dass Sie Spuren des Edelgoldfarnes in dem Museum gefunden hatten, Sie einfach hierherkommen und Ray und seinen Bruder verhaften lassen?«
Ich atmete tief durch. Rathbone und seine Männer waren also Verräter. Warum hatte ich das nicht kommen sehen? Seine Ausrede, hier draußen zu warten, war mir schon sehr merkwürdig vorgekommen. Aber dass er gleich zur anderen Seite gewechselt war, schockte mich schon ein wenig. Doch wer war die andere Seite überhaupt? Nur Raymond Sterling?
Meine Gedanken glitten zurück zu einer Begegnung, die schon eine ganze Weile zurücklag. Damals hatte mich ein geheimnisvoller Mann zu einer stillgelegten Bahnhofstoilette gelockt, um mir einige Informationen über Rays Aktivitäten zu geben. Viel hatte ich nicht erfahren können, bevor es ihn erwischt hatte, aber er hatte erwähnt, dass Sterling nur ein kleines Licht und Teil eines viel größeren Plans war. Und dass er so viel Einfluss hatte, die TCA unterwandern zu lassen, bezweifelte ich.
Dabei fiel mir ein, dass Rathbone offenbar unter Superbösewichtsallüren litt und nun die große Zeit für Erklärungen gekommen war, bevor er den Helden (also mich) mutmaßlich endgültig töten würde. Damit hatte ich schon meine Erfahrungen gemacht. Meistens artete das dann darin aus, dass mir mein Gegner seine halbe Lebensgeschichte unter die Nase rieb und ich ihn am Ende doch wieder überwältigen konnte.
Deshalb versuchte ich, auch Rathbone dazu zu bringen, so eine Rede zu schwingen. »Warum haben Sie dann nicht einfach Ray und seinen Bruder mit dem Gemälde in Sicherheit gebracht?«
»Weil ich erst vor einigen Stunden erfahren habe, dass Sie den Farn in dem Museum gefunden haben. Nachdem ich meine Partner gewarnt hatte, kam uns die Idee, Sie in eine Falle zu locken.«
Nicht gerade besonders logisch. Mir war es aber egal. Ich wies auf die Bruchbude, in der ich stand. »Warum überhaupt dieses Haus als Versteck?«
Rathbone grinste weiterhin. So langsam musste er dabei Muskelkrämpfe bekommen. »Niemand wusste davon, dass dieses Haus überhaupt existiert. Niemand außer William Sterling. Dieser Verrückte hat sich nach seinen Morden – fragen Sie mich nicht, warum er diese Voodoo-Typen umgelegt hat – hier in diesem Wald versteckt und dabei das Haus entdeckt. Dort hat er sich dann einquartiert, bis ihn sein Bruder wieder gebraucht hatte. Nach dem Einbruch in Paris sollten sich die beiden dann darin verstecken, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ausgenommen natürlich die Mona Lisa. Die sollte sowieso in …«, er blickte auf seine Armbanduhr, »fünf Minuten abgeholt werden.«
»Und was hatte es mit den sombras auf sich?«
»Wem?«
So gut schien der gute Rathbone wohl doch nicht informiert zu sein. Wahrscheinlich erhielt er von seinen Auftraggebern nur das nötigste Wissen mitgeteilt.
»Egal«, antwortete ich. »Darf man fragen, für wen Sie eigentlich arbeiten?«
»Darf man.« Der Typ grinste tatsächlich immer noch. Ob er sich während meiner Abwesenheit Botox in die Backen gespritzt hatte? »Aber ich werde es Ihnen nicht verraten. Nur so viel: Sterling ist nicht mein oberster Boss.« Er winkte mit seiner MP. »So, und jetzt werde ich Sie mit ihrem Wissen ins Grab schicken. Kommen Sie langsam auf uns zu und lassen Sie Ihre Waffe fallen!«
Sollte ich versuchen, im Haus Deckung zu suchen, obwohl vier MPs direkt auf mich gerichtet waren? Ich entschied mich dagegen. Vielleicht ergab sich ja noch eine bessere Chance, obwohl sich die wohl nur in der Anzahl der Kugeln, die mich erwischen würden, von der ersten Alternative unterschied. Wenigstens blieb mir die Gewissheit, dass sie wohl nicht mit weiteren Überlebenden rechneten und somit zumindest Tanja Berner aus dem Schneider war.
Langsam schritt ich auf die Verräter zu und ließ dabei meine Desert Eagle fallen.
Einer von Rathbones Männern ging auf mich zu, packte mich am Kragen und stieß mich ins hohe Gras. Ich versuchte mich wieder aufzurichten, doch da erschien Rathbones MP vor meinen Augen.
Im Hintergrund hörte ich das Rattern eines Hubschraubers, das sich schnell näherte.
Der Commander trug weiter sein Botox-Lächeln spazieren. »Es wird mir eine Ehre sein, Sie töten zu dürfen. Viele haben es bereits vor mir versucht, aber nun ist es endlich soweit.« Er legte direkt auf meinen Kopf an. »Nun, Mr. Spider, was soll Sie jetzt noch retten?«
Das fragte ich mich auch, doch während ich langsam meine gedanklichen Memoiren schrieb, erschien plötzlich ein roter Punkt auf Rathbones Brust-Uniform.
Mit meinem linken Zeigefinger wies ich auf den Punkt, um seine Frage zu beantworten.
Ungläubig wanderte Rathbones Blick auf seine Uniform. »Was zum …?«
Im nächsten Moment erklang ein Schuss. Rathbones Brust wurde trotz der kugelsicheren Weste förmlich aufgerissen, während ihn die Wucht des Geschosses nach hinten schleuderte.
Sekunden später traf es auch den ersten seiner Männer. Mitten in die Stirn schlug eine Kugel ein und ließ ihn zusammensacken. Die übrigen beiden schossen ziellos in der Gegend herum, bevor auch sie getroffen wurden. Tot brachen sie zusammen.
Aber wer hatte geschossen und mir damit das Leben gerettet? Tanja Berner konnte es nicht gewesen sein, denn die Schüsse waren aus dem Wald und nicht vom Haus her abgegeben worden.
Ich richtete mich auf und ließ meinen Blick wandern. Niemand war zu sehen. Doch, zwischen zwei abgestorbenen Bäumen sah ich eine schwarze Gestalt hindurch huschen.
Sofort lief ich los und nahm die Verfolgung auf.
»Warten Sie!«, schrie ich dem Schützen hinterher.
Als ich die beiden Bäume erreicht hatte, war von ihm jedoch nichts mehr zu sehen. Keine Spur, keine huschende Gestalt im Wald. Nichts. Der Schütze war und blieb verschwunden. Aber wer war er – oder möglicherweise sie – überhaupt?
Plötzlich stoppte ich. An einem der beiden morschen Baumstämme hing etwas.
Ein Stück Papier war dort mit einem in den Stamm gestochenen Dolch befestigt worden.
Ich zog ihn heraus und nahm den Zettel in die Hand. Eine Nachricht meines Retters?
Viel stand nicht darauf, nur eine Art Ortsangabe.
TCA Headquarter
House B
Room 214
Ich überlegte, was das zu bedeuten haben könnte. House B? Mir fiel ein, dass ich mich schon immer gefragt hatte, warum die TCA-Zentrale in Manchester mit House A beschriftet worden war. Ein House B gab es nämlich nicht. Oder etwa doch?
Etwas riss mich aus meinen Gedanken. Das Rattern des Hubschraubers – er war also angekommen.
Ich steckte mir den Zettel in die Hose und lief los. Zunächst machte ich einen Abstecher zum Hauseingang, vorbei an dem toten Rathbone (seine Schutzweste war wohl zu schwach für die Kugel gewesen), und sammelte dort meine Desert Eagle auf. Dann folgte ich dem Krach, den der Hubschrauber veranstaltete.
Endlich sah ich ihn am Himmel kreisen, aber es war schon zu spät. Zwei Gestalten hingen an einer heruntergelassenen Strickleiter und wurden mit ihr in die Lüfte gezogen.
Ich hob meine Desert Eagle an und zielte auf die obere Gestalt. Zweimal drückte ich ab. Aber statt dass der Flüchtende zusammenzuckte, traf ich eine hinter ihm fliegende Taube und bereitete den Krokodilen damit ein kleines Festmahl.
Nun war es auch zu spät. Der Hubschrauber flog außer Reichweite.
Die Aktion war also ein Schlag ins Wasser gewesen. Sterling war mit der Mona Lisa entkommen. Aber immerhin hatte ich das schwarze Monchoppie erledigen und einen Verräter enttarnen können.
Dafür waren die Rätsel aber nicht geringer geworden, da musste ich nur an den Zettel denken.
Dennoch, für eine Siegerzigarre reichte das leider nicht. Und selbst wenn, sie hatte wohl bei dem Säureangriff dran glauben müssen …
***
Der Rest der Geschichte war schnell erzählt: Dank der Funkgeräte von Rathbones Männern hatten Tanja und ich einen Rettungshubschrauber rufen können. Jack Kasahara war wirklich ein zäher Bursche und hatte es tatsächlich ins Krankenhaus geschafft.
Nachdem Tanja und ich uns von ihm verabschiedet hatten, waren wir sofort nach Manchester zurückgeflogen, um Dave Logger dort im Krankenhaus zu besuchen. Der war schon wieder zu Scherzen aufgelegt und hatte sich bereits von mir eine Flasche Whisky ins Krankenzimmer schmuggeln lassen.
Auf einen detaillierten Bericht an meinen Chef verzichtete ich vorerst. Zumindest hatte ich ihn im Flugzeug kurz über den Stand der Dinge unterrichtet. Begeistert war er freilich nicht gewesen, aber damit mussten wir leben.
Zunächst einmal brauchte ich Ruhe und zog mich deshalb in meine Wohnung zurück.
Es war bereits dunkel geworden, und eigentlich suchte ich nur noch den schnellsten Weg ins Bett. Dagegen hatte offenbar jemand etwas, denn plötzlich klingelte das Telefon.
Ich überlegte kurz, ob ich den Apparat einfach aus dem Fenster werfen sollte, entschied mich aber doch dagegen und nahm schließlich den Hörer ab.
»Ja bitte?«
»Spreche ich mit Jimmy Spider?«, erklang eine kratzige Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Nein, hier ist das Sekretariat des Weihnachtsmannes. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, mein Vorgesetzter ist auf Hochzeitsreise mit dem Osterhasen.«
»Sehr witzig, Mr. Spider. Aber jetzt hören Sie genau zu: Ich habe Informationen für Sie, die von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Es geht um die Mona Lisa, die sombras und alles, was dahinter steckt. Treffen Sie mich in drei Stunden am alten Scottish Cinema. Es wird sich für Sie lohnen.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, legte der Anrufer auf …
Copyright © 2010 by Raphael Marques


